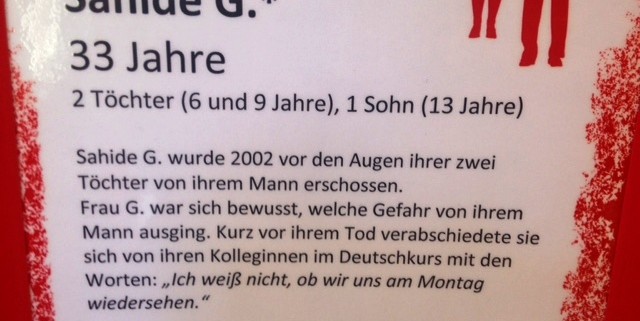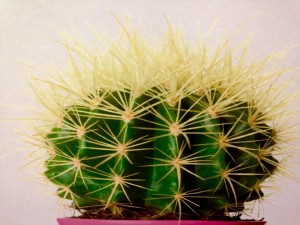Anmerkungen zum Verhältnis von Religion und Staat auf der Grundlage der Menschenrechte.
Josef P. Mautner

Moschee in Istanbul
Mit der wachsenden militärischen Durchsetzungskraft der Gewaltherrschaft des sog. „Islamischen Staates“ in weiten Gebieten des Irak und Syriens, vor allem jedoch durch die Anschläge im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ ist die Diskussion um das Verhältnis von Religion und (staatlicher) Gewalt sowie verschiedenen religiösen Traditionen und dem sich auflösenden Gewaltmonopol in unterschiedlichen staatlichen Strukturen neu aufgeflammt. Unter dem Eindruck der zweiten, noch verheerenderen Anschlagserie wird sich diese Debatte noch weiter zuspitzen. Was ich weiters befürchte: Sie wird möglicherweise auf die Ebene Sicherheitspolitik und Kontrolle zugespitzt und verengt bleiben. Ein zentrales Faktum ist bislang eher im Hintergrund geblieben: dass der „Islamische Staat“ in seinem Selbstverständnis sowie bereits in seiner Selbstbezeichnung jede Ausdifferenzierung zwischen institutionalisierter Religion und staatlichen Strukturen leugnet – geschweige denn eine Trennung zwischen Religion und Staat anerkennen will.
Einheit von Religion und Staat in der Ideologie des „Islamischen Staates“
Der „Islamische Staat im Irak“ (ISI) wurde bereits im Oktober 2006 in einer Videobotschaft durch einen Vertreter des „ISI-Informationsministeriums“ ausgerufen. Anfang 2007 wurde schließlich ein 90 Seiten umfassendes Staatsgründungsmanifest veröffentlicht.[1] Als zentrale politische Legitimation für die Ausrufung dieses „Staates“ wurde in dem Manifest angegeben, dass die Sunniten im Irak – im Unterschied zu den Kurden und den Schiiten – noch immer keinen eigenen Staat kontrollierten und deshalb Muslime unter Fremdherrschaft seien. Diese politische Situation stehe – gemäß der religiösen Begründungsfigur des Manifestes – im direkten Widerspruch zu Aussagen des Propheten Mohammed, die in den Hadith-Sammlungen überliefert sind. Einer der Hadithe aus dem Sahih-Werk von Imam Muslim überliefert einen Ausspruch des Propheten, der besagt, dass die Herrschaft über die muslimischen Angehörigen seines Stammes (der Quraisch) ausschließlich den Muslimen unter den Quraisch gebühre.[2] Daraus leitet das Manifest die zentrale politische Zielsetzung der Errichtung eines „Kalifates“, d.h. eines „authentischen“ islamischen Staatswesens ab, das von einem direkten Nachfolger des Gesandten Gottes (des Propheten Mohammed) geführt werde. Weltliche und geistliche Herrschaft sind – gemäß dem Manifest – im Kalifat vereint. Es geht von einer untrennbaren Einheit von Religion und Staat aus.
M.E. genügt es nicht, den „Islamischen Staat“ (IS) mit dem Hinweis auf seine verbrecherische Kriegsführung sowie die von ihm begangenen Verbrechen gegen die nicht am Krieg beteiligte Zivilbevölkerung zu delegitimieren. Es bedarf auch einer stringenten Kritik seines religionspolitischen Grundkonzeptes: der behaupteten notwendigen Einheit von Religion und Staat.
Ich habe weder die Legitimation noch die Kompetenz, eine solche Kritik aus islamischer Perspektive vorzutragen, möchte jedoch zumindest einige wesentliche Passagen aus Stellungnahmen offizieller islamischer Institutionen zitieren, um zu verdeutlichen, dass eine solche Kritik von muslimischer Seite bereits geleistet wurde.[3] Selbstverständlich werden in allen diesen Stellungnahmen die Verbrechen des IS aufs schärfste verurteilt und als mit dem Islam unvereinbar erklärt. Ich konzentriere mich hier jedoch ausschließlich auf die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Staat im Kalifatskonzept des IS. In seiner Stellungnahme zum IS weist der Großmufti der Al-Azhar Universität den Anspruch des IS, ein muslimisches Kalifat zu errichten, mit Hinweis auf die Tradition entschieden zurück. Er verneint eine vorgängige Einheit von Religion und Staat im Kalifat und verweist darauf, dass die muslimische Tradition nicht einig war in der wesentlichen Frage, ob das Kalifat eine religiöse oder eine politische Institution sein sollte:
„Historically speaking, Muslims have disagreed over the question of whether the caliphate is a religious obligation or merely a political option as they likewise disagreed over the specific connotation of several texts upheld by some religious schools.“
In einem Offenen Brief vom 27. September 2014 an Dr. Ibrāhīm ʿAwwād al-Badrī alias „Abū Bakr al-Baġdādī“ und an die Kämpfer und Anhänger des selbsternannten „Islamischen Staates“ – unterzeichnet von über 120 Gelehrten – wird das Kalifat zwar als legitimer Teil der islamischen Tradition bejaht, jedoch die Form des Kalifates, wie der IS sie versteht und praktiziert, aus zwei Gründen zurückgewiesen:
„Es ist im Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten.“
„Loyalität zur eigenen Nation ist im Islam gestattet.“
Die Stellungnahme der VertreterInnen der Standorte für Islamisch-Theologische Studien in Deutschland (Frankfurt/Main, 1. September 2014) bejaht nicht nur vorbehaltlos die demokratisch-freiheitliche Grundordnung europäischen Staatsdenkens, sondern betrachtet sie als wichtige Chance, den Islam unter gegenwärtigen Bedingungen authentisch zu reflektieren und zu leben:

Kirche in Metz
„In demokratisch-freiheitlich verfassten Staaten Europas sehen wir demgegenüber die Chance, an das reiche Erbe der geistesgeschichtlichen und religiösen Tradition des Islam anzuknüpfen und uns in der Begegnung mit anderen, auch kritischen Perspektiven zu öffnen. (…) Nur durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit der islamischen Lehre und Praxis unter freiheitlichen Bedingungen lässt sich die islamische Wissens- und Normenproduktion von krisenhaften Verhältnissen und Kontexten der politischen Repressionen entkoppeln. Und nur so können produktive Antworten des Islam auf die Herausforderungen des globalen Zusammenlebens gefunden werden.“
Privatisierung von Religion als Antwort?
In der europäischen Debatte um den IS sind immer wieder zwei komplementäre Positionen hervorgetreten, die dem Extremismus des Einheitsdenkens des IS wiederum mit extremen Antworten begegnen: Die eine Antwort knüpft an die bereits seit längerem virulente Tradition antiislamischer Vorurteilsmuster an, indem sie in verschiedensten Varianten eine zumindest indirekte geistige Kontinuität zwischen dem Mainstream der islamischen religiösen Tradition und dem islamistischen Extremismus – etwa von AlQuaida oder IS – behauptet. Der deutsch-jüdische Publizist Henryk M. Broder bietet mit seinen rhetorischen Fragen in einem in der Zeitung „Die Welt“ erschienen Kommentar eine exemplarische Argumentationsfigur an:
„Kann schon sein, dass Islam und Islamismus – zu dem es inzwischen auch einen Komparativ gibt: den radikalen Islamismus – nicht ganz deckungsgleich sind. Aber der Übergang ist fließend. Gehören Hamas, die in Gaza das Sagen hat, und Hisbollah, die im Libanon an der Regierung beteiligt ist, zum Islam-Flügel der Umma, während Boko Haram, al-Qaida, al-Nusra, al-Schabaab, die Sauerland-Gruppe und die beiden nigerianischen Konvertiten, die am 22. Mai 2013 den britischen Soldaten Lee Rigby mitten im Londoner Stadtteil Woolwich buchstäblich zu Tode hackten, eher zum Islamismus neigen? Klar ist nur eines: Sie werden alle vom Islamischen Staat getoppt. Und es wird nicht ewig dauern, bis irgendeine noch radikalere Gruppe den IS toppen wird.“[4]
Diese Positionen reichen bis zu der Feststellung, ein reformierter und Säkularität anerkennender Islam sei nicht existent. Er sei nur die Wunschphantasie der euroamerikanischen Eliten, die ihre Bündnisse mit islamischen Eliten nicht aufs Spiel setzen wollten. „Heute aber ist der reformierte und säkularisierte Islam nahezu inexistent. Sich dies nicht einzugestehen (…) ist die reinste Heuchelei des westlichen Establishments, das sich in erster Linie dafür interessiert, sich mit seinen islamischen Partnern die oberste Religion zu teilen, die des Mammons“.[5]
Die zweite Antwort greift die Tradition eines radikalen Säkularismus auf, der eine generelle Tendenz von Religionen zu Intoleranz und Gewalt behauptet und als einzig mögliche Antwort darauf eine radikale Trennung von Staat und Religion sowie die Verbannung der Religion aus dem öffentlichen Raum sieht. Paolo Flores D‘ Arcais hat in seinem bereits zitierten Artikel zum Anschlag auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ genau diese Ausschließung jeglicher Religion aus dem öffentlichen Raum gefordert und sie als zentrale Zielsetzung eines notwendigen Kulturkampfes postuliert: „Wenn im öffentlichen Raum das Wort Gottes zulässig ist, wird es keinen Raum des zivilen dia-logos mehr geben, sondern nur noch eine Arena für das Gottesurteil (…) Eine Logik, die mit Demokratie und Staatsbürgerlichkeit unvereinbar ist.“[6]
Ähnliche Denk- und Argumentationsmuster weist jene Debatte auf, die im deutschen Sprachraum über die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit geführt wurde, die modernen Menschenrechte mit dem Begriff der „Menschenwürde“ zu begründen. Eine Reihe von Autoren hat dabei die Ansicht vertreten, dass mit dem begründenden Verweis auf die Menschenwürde in der Verfassung (etwa der BRD) der Staat ein religiöses bzw. zivilreligiöses Bekenntnis ablegen würde, das seine prinzipielle Säkularität in Frage stelle.[7] Hinter dem grundsätzlichen Postulat einer unantastbaren Menschenwürde verberge sich eine religiös aufgeladene Norm, die den scheinbar weltanschauungsneutralen Staat wiederum religiös parteilich mache. Menschenwürde als Begründungsprinzip der Menschenrechte diene letztlich dazu, „den normativen Konsequenzen eines stillschweigend vorausgesetzten religiösen Menschenbildes eine scheinbare säkulare Legitimation zu geben.“[8] Und deshalb sei jeder begründende Verweis auf die menschliche Würde – als kryptoreligiösem Begriff – in verfassungsrechtlichen Zusammenhängen zurückzudrängen.[9]
Offene und differenzierte Verhältnisbestimmung

Buddhistisches Kloster in Osttibet
Vor dem Hintergrund der Herausforderung des IS und der zum Extrem neigenden Antworten darauf erscheint es mir ein notwendiger Beitrag zur Debatte, das Verhältnis zwischen Religion(en) und Staat auf der normativen Basis der Menschenrechte differenziert und als offenen Entwicklungsprozess zu bestimmen. Eine solche Verhältnisbestimmung gründet auf dem Prinzip der religiös-weltanschaulichen Neutralität eines Staates, der sich säkular versteht. Allerdings ist diese Säkularität nicht im Sinne eines ideologisch bestimmten Laizismus zu interpretieren, der wiederum Weltanschauung ist. Andererseits beinhaltet sie auch keine absolute Werteabstinenz, sondern gründet sich auf den Grundwerten der Menschenrechte – im Besonderen den Grundwert der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dieses Freiheitsrecht beinhaltet den Anspruch auf Gewährleistung ohne jede Diskriminierung für ALLE: für Angehörige von Mehrheits- wie von Minderheitsreligionen, von gesetzlich anerkannten oder nur vereinsrechtlich institutionalisierten Religionen, für Religionsfreie, Atheisten wie Agnostiker*innen etc. Das Faktum, dass dieses Menschenrecht ein absolut und universal geltendes Recht ist[10] und dass es allen Menschen ohne jeden Unterschied in gleicher Weise zusteht, unterscheidet es von allen Formen einer auf dem Toleranzprinzip beruhenden Religionspolitik. Toleranzpolitik könnte jederzeit die Gewährung von Rechten für eine Religionsgemeinschaft einschränken oder zurückziehen, wenn sie staatspolitische Gründe dafür als gegeben ansieht.[11] Aus dem Prinzip der Gleichberechtigung in der Religions- und Weltanschauungsfreiheit resultiert die spezifische Form einer auf den Menschenrechten gründenden Verhältnisbestimmung zwischen Religion(en) und Staat: Das Verhältnis des Staates zu den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften , denen seine Bürger*innen angehören (wollen), ist das einer auf Respekt beruhenden religiös-weltanschaulichen Abstinenz, die der prinzipiellen Differenz zwischen Religion(en) und Staat Rechnung trägt.[12] Der Staat verzichtet damit auf das besondere Bezogensein auf oder gar die Identifikation mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung. Er gibt kein Heilsversprechen und keine Sinnorientierung. Andererseits behauptet er aber einen prinzipiellen, nicht weltanschaulich gebundenen Vorrang gegenüber religiös-weltanschaulichen Normen. Religiöse Gesetze gelten nur, insoweit sie sich innerhalb der Rechtsordnung einer demokratisch-freiheitlichen Verfasstheit auf menschenrechtlicher Basis bewegen. Nur durch diesen pragmatischen Geltungsvorrang kann auch der Freiheitsraum garantiert werden, den es braucht, damit die Bürger*innen eines Staates ihre Religions- und Weltanschauungsfreiheit unbedingt und gleichberechtigt leben können, damit radikale Religionskritik und religiöser Traditionalismus in einer Gesellschaft Platz finden und Teile eines öffentlichen Diskurses sein können. Diese Form der nichtidentifikatorischen Beziehung zwischen Religion(en) und Staat beinhaltet zum einen das Recht auf Öffentlichkeit wie zum andern auch das Recht auf Kritik und Respekt (selbstverständlich auch auf Kritisiert- und Respektiertwerden) für ALLE: für Religiöse wie für Religionsfreie, für Religionsgegner*innen wie für die Anhänger*innen verschiedener Religionen. Dieses Recht beinhaltet allerdings auch die Verpflichtung auf Einhaltung ebendieser Prinzipien, die ich für mich selbst beanspruche, gegenüber den Anderen: also die Pflicht zum Respektieren der differenten Position – gerade dann, wenn sie weh tut. Zum einen kann es sich dabei etwa um das Akzeptieren einer Form von Religionskritik handeln, die ich als Gläubige*r als „Blasphemie“ verstehe. „Blasphemie“ ist jedoch für bestimmte atheistische Positionen schlicht nicht vorhanden. Denn für deren Vertreter*innen handelt es sich bei Aussagen, die von religiös gebundenen Menschen als „blasphemisch“ qualifiziert werden, um nichts anderes als um die Kritik einer Ideologie, die Gott zum Legitimationsprinzip erklärt. Zum andern kann es sich darum handeln, dass ich als Vertreter einer agnostischen Weltanschauung respektiere, dass das Tragen eines Kopftuches für muslimische Frauen Ausdruck der Freiheit ihrer Religionsausübung sein kann. Denn das Kopftuch zu tragen – was für mich vielleicht lediglich eine Ausformung kultureller Traditionen ist – ist für sie eine religiöse Norm, die auch Teil der Überlieferung des Islam ist. Gerade auch vor diesem Hintergrund sind die Debatten über die Il-Legitimität von Blasphemieverboten oder über die Wahrnehmung von Religions- und Weltanschaungsfreiheit zu führen. Das Recht auf Artikulation von religiösen Überzeugungen und Riten im öffentlichen Raum beinhaltet eben auch als Konsequenz, sich, seine Argumente und seine institutionelle Praxis der öffentlichen Wahrnehmung sowie einem öffentlichen Diskurs auszusetzen. Die Debatte um das „König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ in Wien ist m.E. exemplarisch dafür. Auf der Grundlage respektvoller Unterschiedlichkeit entwickeln sich in einem offenen Prozess auch die verschiedensten Formen der Kooperation zwischen dem Staat und religiösen Institutionen: etwa beim Bau von Gebetsstätten, von Begräbnisstätten, in der Bildungsarbeit und beim Religionsunterricht.
Ein wichtiger Schritt, den staatliche Institutionen in ihrem Verhältnis zu den Religionsgemeinschaften setzen können, ist die Einrichtung interreligiöser Beiräte auf kommunaler, regionaler wie nationaler Ebene. Solche Beiräte oder Arbeitskreise gibt es bereits in mehreren Städten, z.B. in Hallein, Graz, Heilbronn, Berlin (Berliner Dialog der Religionen) oder Leipzig (Interreligiöser Runder Tisch). In der Arbeit solcher Beiräte kann die Kooperation zwischen staatlichen und religiösen Institutionen vertieft und koordiniert, das Prinzip der Gleichberechtigung zwischen Minderheiten- und Mehrheitsreligionen gelebt und eine religiös-weltanschaulich neutrale Plattform für den Ausdruck gemeinsamer Werthaltungen geschaffen werden – etwa, wenn alle in einem Beirat vertretenen Religionsgemeinschaften gegen antisemitische oder antiislamische Äußerungen bestimmter Gruppen in Wahlkampfzeiten koordiniert und gemeinsam auftreten. Ein noch offenes Desiderat ist m.E. die Einbindung von religionsfreien Gemeinschaften und Institutionen in solche Beiräte, damit diese Form religiös-weltanschaulicher Kooperation im Dreieck zwischen Religionsgemeinschaften, Religionsfreien und staatlichen Institutionen stattfinden kann und nicht nur auf den Dialog Staat – Religion beschränkt bleibt. Es wäre sehr sinnvoll und wünschenswert, wenn ein solcher Interreligiöser und Interweltanschaulicher Beirat auch in Salzburg – wie es auf kommunaler oder auf Landesebene – eingerichtet würde. Gerade die Verschärfung antiislamischer Tendenzen, die auch in Salzburg im Gefolge der Debatten um den IS und die Pariser Anschläge zu spüren war, zeugt von der Notwendigkeit, koordinierter und institutionalisierter Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen und Religions- sowie Weltanschauungsgemeinschaften.
[1] Eine Analyse des Manifests findet sich in der Studie von Christoph Günther: Ein zweiter Staat im Zweistromland? Genese und Ideologie des ‚Islamischen Staates Irak‘.
[2] Sahih Muslim Nr. 3389: „Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete; Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Die Herrschaft über die Leute (d.h. die Araber) gebührt den Quraisch: Die Muslime der Quraisch sind den Muslimen der Quraisch unterworfen, und die Ungläubigen der Quraisch sind den Ungläubigen der Quraisch unterworfen.“
[3] Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) hat auf ihrer Website eine Reihe solcher Stellungnahmen zusammengefasst: http://www.ciag-marl.de/attachments/article/46/Islamische%20Stellungnahmen%20zum%20IS.pdf.
Eine Sammlung von internationalen christlichen wie muslimischen Äußerungen gegen IS findet sich auch auf der Website der christlich-islamischen Begegnungsstätte der deutschen katholischen Bischofskonferenz: http://www.cibedo.de/islamischerstaat.html.
[4] http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article132498528/Liebe-muslimische-Mitbuerger-und-Mitbuergerinnen.html.
[5] So der prominente italienische Publizist Paolo Flores D‘ Arcais in einem Artikel der Zeitschrift „Lettre International“: Wer ist Charlie?, 14. In: Lettre International 108, Frühjahr 2015, 11-17.
[6] Paolo Flores D‘ Arcais: Wer ist Charlie?, 15. In: Lettre International 108, Frühjahr 2015, 11-17.
[7] so u.a. Norbert Hoerster, Franz-Josef Wetz oder Stefan Lorenz Sorgner (Hoerster: Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den §218. Frankfurt/Main 1991; Wetz: Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts. Stuttgart 2005; Sorgner: Menschenwürde nach Nietzsche. Die Geschichte eines Begriffs. Darmstadt 2010).
[8] Hoerster, Abtreibung, a.a.O., 121.
[9] Dem entsprechen auf der anderen Seite christlich-konservative bzw. rechtskonservative Positionen, die die Menschenwürde tatsächlich als säkulare Fortführung eines (christlich-)religiösen Prinzips sehen; z.B. Anton Rauscher: Die christlichen Wurzeln der Menschenwürde. In: Ders.: Kirche in der Welt, Bd. 4. Würzburg 2006, 189-197. Eine differenzierte, klärende Erörterung zu dieser Debatte findet sich bei Heiner Bielefeldt: Auslaufmodell Menschenwürde? Freiburg/Breisgau 2011, 145ff.
[10] Verankert etwa in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Österreich in Verfassungsrang steht.
[11] Eine fatale Tendenz zur Toleranzpolitik zeigt der Prozess einer Neuformulierung des Islamgesetzes in Österreich, wo islamophobe Tendenzen in der Gesellschaft und die aktuelle Debatte um den IS zu Elementen einer Anlassgesetzgebung geführt haben.
[12] Heiner Bielefeldt hat dafür den Begriff der „respektvollen Nicht-Identifikation“ geprägt; siehe: Heiner Bielefeldt: Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft. Bielefeld 2007, 77ff.