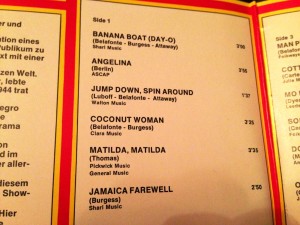Rechtzeitig zum Finale der Salzburger Festspiele ein Kommentar von Gerhard Scheidler :
:
Neulich wieder mal geärgert! Da verlangt doch eine schreibende Kollegin in einer großformatigen Salzburger Tageszeitung doch glatt, die Subventionen für die Salzburger Festspiele zu erhöhen. Geht’s noch?! Klar, wir verjuxen ja für alles Mögliche unser Geld, zum Beispiel für die Verdoppelung der ohnehin schon weltweit spitzenmäßig hohen Parteienförderung, für doppelte und dreifache Verwaltung, für großflächige Inserate im journalistischen Abschaum des heimischen Blätterwaldes etc. Da kommt’s auf ein paar Milliönchen mehr oder weniger auch nicht mehr an. Jetzt aber mal im Ernst. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen von ihrem (sogar Full-Time-)Job nicht leben können und der Staat an allen Ecken und Enden (und hier sind ja bekanntlich immer die Schwächsten daheim) sparen muss, höhere Subventionen für einen Millionenbetrieb zu fordern, ist erstens dreist und zweitens aber eben auch ein immer wiederkehrender, scheinbar automatischer Reflex der Kulturszene. Stopp! Ohne jetzt für eine Kritik an diesen Zeilen zu dünnhäutig zu sein, aber um gleich den wichtigsten Gegenargumenten entgegenzutreten – erstens: Dies ist kein Plädoyer für mehr Unterstützung für den Sport zu Lasten der Kunst. Im Gegenteil: Auch – und besonders – im Sport liegt Vieles im Argen, angefangen von der Seuche Doping über Kriminalität bis in höchste Etagen wie FIFA und IOC. Und auch regional kann beim Sport an Förderungen genügend eingespart werden oder zumindest besser verteilt werden. Oder warum soll man einen Amateur-Fußballverein auch nur mit 500 Euro – angeblich für den Nachwuchs – unterstützen, wenn der dann unter der Hand teure Spieler kauft, nur um dem Nachbarklub eins auszuwischen? Wenn ein Verein einen finanziell potenten Sponsor an der Hand hat, kann von den Euros ruhig auch was für den Nachwuchs übrig bleiben, ohne dass man damit die Allgemeinheit belasten muss – und von Stadion-Zufahrtsstraßen für Profi-Neureichen-Klubs ganz zu schweigen. Zweitens zurück zur Hochkultur: Kulturförderung – ein klares Ja! Aber da, wo’s nötig ist. Denn, kann mir das einer erklären, wie es bei den Festspielen trotz längerer Laufzeit, trotz Rekord-Einnahmen bei den Ticket-Verkäufen und beim Sponsoring zu einem (möglichen) Verlust und daraus resultierenden Rufen nach mehr Subventionen kommen kann? Schlüssig wohl niemand. Und das, obwohl eh gespart wird, wo’s nur geht – also bei den weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern, beim Personal, bei den Unterkünften. Nicht umsonst ernten die Facebook-Gruppe „Die traurigsten & unverschämtesten Künstler-Gagen und Auditionerlebnisse“ und die Interessenvertretung „art but fair“ derzeit so viel Zuspruch. Anstatt ideenlos und automatisch mehr Geld zu fordern, wie wär’s mal, die Gagen der hochbezahlten Superstars (das gilt für Sport, Kultur und Wirtschaft gleichermaßen) in Frage zu stellen und die gar zu unterschiedliche Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern zu thematisieren? Es ist halt so, wie es immer ist – in Wirtschaft, Sport und Kultur: Die oben kassieren ab, die unten werden ausgebeutet. Nach mehr Subventionen zu schreien, ist der falsche Ansatz.
Der Autor ist Journalist, Kabaretttexter und Gründer von „Comedy im Pub“