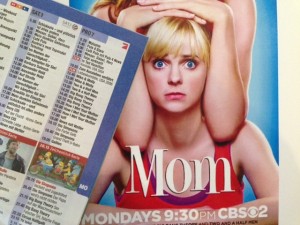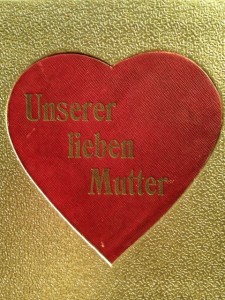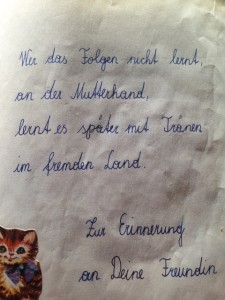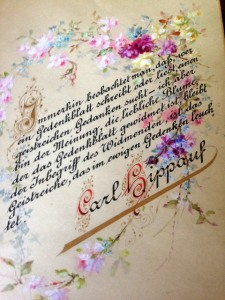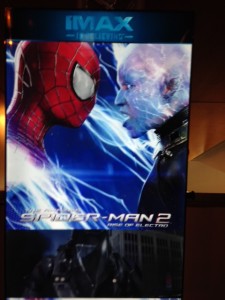 Als „The Amazing Spiderman“ vor zwei Jahren anlief, war ich nicht sicher, ob ich mir den Neustart einer ganz neuen Reihe von Spiderman Filmen überhaupt antun soll. Die Spiderman Filmreihe des Regisseurs Sam Raimi hatte es auf drei Teile gebracht. Das war ok, aber es hätten meinethalben auch ruhig mehr sein können. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass sie endet. Tobey Maguire als nerdiger Peter Parker mit stets treudoofem Blick und James Franco als sein Frenemy/Gegenspieler Harry Osborn alias Green Goblin. Ach ja, Kirsten Dunst war auch dabei. Aber sonst war alles so perfekt.
Als „The Amazing Spiderman“ vor zwei Jahren anlief, war ich nicht sicher, ob ich mir den Neustart einer ganz neuen Reihe von Spiderman Filmen überhaupt antun soll. Die Spiderman Filmreihe des Regisseurs Sam Raimi hatte es auf drei Teile gebracht. Das war ok, aber es hätten meinethalben auch ruhig mehr sein können. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass sie endet. Tobey Maguire als nerdiger Peter Parker mit stets treudoofem Blick und James Franco als sein Frenemy/Gegenspieler Harry Osborn alias Green Goblin. Ach ja, Kirsten Dunst war auch dabei. Aber sonst war alles so perfekt.
Letztlich gefiel mir dann aber der erste Teil der neuen Reihe „The Amazing Spiderman“ unerwartet gut. Ich war begeistert von Andrew Garfield als schlacksigem Peter Parker/Spiderman mit verschmitztem Grinsen. Aber auch von der hinreißenden Emma Stone als seine Freundin Gwen Stacy, die ebenfalls Superkräfte hat – irgendwie. Sie ist überdurchschnittlich intelligent und steht davor, in Oxford einen Elitestudienplatz zu bekommen. In manchen Situationen stellt es sich einfach als effektiver heraus, wenn man sich in Naturwissenschaften auskennt, anstatt ordentlich wo draufzuhauen. Anders als Kirstin Dunst als Mary Jane in Sam Raimis Spiderman Filmen darf Emma Stone nicht nur pausenlos in schwindelnden Höhen schwingen und auf die Rettung durch Spidey hoffen. Sie ergreift selbst Initiative. Peter und Gwen geben auch ein gutes Paar ab, das viel Leichtigkeit und Witz in die Sache bringt.
Ich möchte mich diesmal gar nicht mit Details zur Handlung aufhalten. Ich bin nämlich nicht wirklich sicher, ob ich alles gut genug behalten habe. Es ist in den 2 Stunden 20 Minuten Laufzeit viel los und alles geht sehr rasant. „The Amazing Spiderman“ ist laut, bunt, komisch – und wahnsinnig schnell.
Andere Comic-Verfilmungen haben oft das Problem, dass sie es mit der Action und mit den vielen Superschurken zu gut meinen und mit ewigen und nicht mehr nachvollziehbaren Verfolgungsjagden und Nahkampfszenen für das eine oder andere Gähnen sorgen. Ein ganz krasses Beispiel dafür war im letzten Jahr „Man of Steel“ (vulgo Superman), der dachte, er müsse es nur ordentlich krachen lassen und die Leute würden dadurch nicht bemerken, wie viele Schwachstellen und Löcher der Film hat und wie platt und uninteressant seine Charaktere waren. „Men of Steel“ hätte mich fast dazu gebracht, Comic-Verfilmungen auf ewig abzuschwören.
 „The Amazing Spiderman“ macht jedoch diesen Fehler nicht. Er bringt zwar ebenso viele Schurken und bietet haufenweise rasante Action, jedoch ganz ohne Längen. Er vergisst nämlich nicht, dass die eigentliche Geschichte auf der menschlichen Ebene stattfinden muss, damit es für die Zuschauer interessant bleibt.
„The Amazing Spiderman“ macht jedoch diesen Fehler nicht. Er bringt zwar ebenso viele Schurken und bietet haufenweise rasante Action, jedoch ganz ohne Längen. Er vergisst nämlich nicht, dass die eigentliche Geschichte auf der menschlichen Ebene stattfinden muss, damit es für die Zuschauer interessant bleibt.
Wen Spiderman eigentlich bekämpft? Jamie Foxx als wunderbaren total überzeichneten Vollnerd Max, der nur beachtet werden und Spidermans bester Freund sein möchte (Jetzt alle: Oooooch!). Als er zum Superschurken Elektro mutiert, bekommt er endlich die lang ersehnte Aufmerksamkeit. Doch Spiderman stiehlt ihm aber das Rampenlicht und so erklärt sich Elektro zu dessen Erzfeind.
Dane DeHaan trägt als Harry Osborn den fiesesten Scheitel, den ein Mittzwanzigjähriger Mann je zu tragen verdammt war (sorry Dane, da werden sich keine weiblichen Teenage-Fans um dich scharen) und so ist seine Transformation (aus Haarneid auf Peter Parkers coole Strubbelfrisur, vermute ich) zum Green Goblin am Ende des Films der einzig logische Verlauf seines Schicksals. Diese Verwandlung bietet schon ein interessantes Setup für den dritten Teil von „The Amazing Spiderman“, der hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lässt.
Spiderman ist eine Gaudi und Action und in IMAX 3D ein Fest für Augen und Ohren, die schon mal die eine oder andere Reizüberflutung ertragen.
Meine Bewertung auf IMDB: 8 Punkte
Kurzweilig und unterhaltsam. Am Ende des Films ist man ganz benommen. Kaum erholt man sich davon, ist allerdings das Meiste weg – leicht konsumiert und leicht vergessen. Aber man soll ja öfter mal für den Augenblick leben – das gilt auch für den Augenblick im Kino.




 Sprachhürden oder nicht – die Darsteller ernteten nach jeder Szene ausgiebigen Applaus konnten am Ende noch dreimal die Bühne betreten, um den großen Schlussapplaus entgegenzunehmen.
Sprachhürden oder nicht – die Darsteller ernteten nach jeder Szene ausgiebigen Applaus konnten am Ende noch dreimal die Bühne betreten, um den großen Schlussapplaus entgegenzunehmen.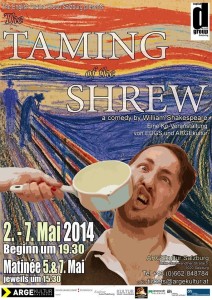
 Ich selbst habe seit 22 Jahren keine Produktion der English Drama Group Salzburg versäumt. Meine große Verbundenheit zu diesem Theaterprojekt kommt freilich daher, dass ich meine ganze Studienzeit über Mitglied der Gruppe war. Die monatelangen Proben und die intensive Zeit während der Aufführungen haben mich stark geprägt: persönlich wie beruflich. Und ich habe in der Drama Group Freunde fürs Leben gefunden.
Ich selbst habe seit 22 Jahren keine Produktion der English Drama Group Salzburg versäumt. Meine große Verbundenheit zu diesem Theaterprojekt kommt freilich daher, dass ich meine ganze Studienzeit über Mitglied der Gruppe war. Die monatelangen Proben und die intensive Zeit während der Aufführungen haben mich stark geprägt: persönlich wie beruflich. Und ich habe in der Drama Group Freunde fürs Leben gefunden.

 Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.
Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.