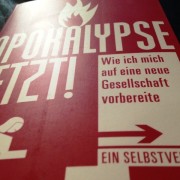Sommerzeit ist Lesezeit, auch wenn es wettermäßig eher Herbst ist. Was wiederum zum Buch passt, das mir unter die Finger gekommen ist. Der Titel klingt eher nach Science Fiction Roman: Apokalypse Jetzt! Aber die Autorin Greta Taubert beschreibt einen Selbstversuch. Ein Jahr lang will sie allem Konsum entsagen. Damit sie vorbereitet ist auf die Apokalypse, wo jeder auf sich selbst gestellt ist, um zu überleben. Ich mag ja Menschen, die Ungewöhnliches machen, also ist es das richtige Buch, um in eine ganz andere Welt einzutauchen. Eine Welt, die nicht Science Fiction ist, sondern real ist.
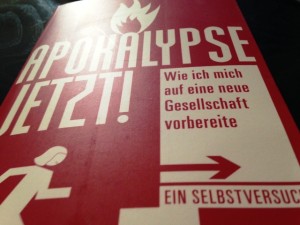 Und das was sie in diesem Jahr kennenlernt ist manchmal freakig und manchmal eigentlich schon Teil des Mainstream. Sie beginnt mit dem Notwendigsten, um zu überleben. Es gibt im Internet genug Anbieter von „Überlebenspaketen“, das sieht sie sich an. Ich mir auch! Da gibt’s unzählige Listen mit Vorschlägen, was man alles braucht. Ganz wichtig scheinen Dosennahrung und Trockenfrüchte zu sein. Natürlich auch Wasser und eine Wasserfilter. Spannender wird das Buch, wenn Greta Taubert über ihre Besuche bei Menschen berichtet, die einfach anders leben. Menschen, die sich in einem Leben mit wenig bis gar keinem Konsum, wie wir ihn tagtäglich leben, eingerichtet haben. Menschen, die von zweierlei leben: Dem was unsere Konsumgesellschaft an Müll produziert und der Solidarität mit anderen. Man mag ja über diese Aussteiger denken, was man will, aber sie haben eines geschafft: Sie halten uns den Spiegel vor! Wir kennen alle die Berichte über das „Waste diving“. Meist junge Leute holen sich aus den Mülltonnen der Supermärkte Nahrungsmittel, die nicht verdorben sind. Alleine die Tonnen von Brot, die täglich im Müll landen, nur weil wir um halb sechs noch frisch aufgebackenes Gebäck aller Sorten haben wollen. Am nächsten Tag ist das natürlich unverkäuflich.
Und das was sie in diesem Jahr kennenlernt ist manchmal freakig und manchmal eigentlich schon Teil des Mainstream. Sie beginnt mit dem Notwendigsten, um zu überleben. Es gibt im Internet genug Anbieter von „Überlebenspaketen“, das sieht sie sich an. Ich mir auch! Da gibt’s unzählige Listen mit Vorschlägen, was man alles braucht. Ganz wichtig scheinen Dosennahrung und Trockenfrüchte zu sein. Natürlich auch Wasser und eine Wasserfilter. Spannender wird das Buch, wenn Greta Taubert über ihre Besuche bei Menschen berichtet, die einfach anders leben. Menschen, die sich in einem Leben mit wenig bis gar keinem Konsum, wie wir ihn tagtäglich leben, eingerichtet haben. Menschen, die von zweierlei leben: Dem was unsere Konsumgesellschaft an Müll produziert und der Solidarität mit anderen. Man mag ja über diese Aussteiger denken, was man will, aber sie haben eines geschafft: Sie halten uns den Spiegel vor! Wir kennen alle die Berichte über das „Waste diving“. Meist junge Leute holen sich aus den Mülltonnen der Supermärkte Nahrungsmittel, die nicht verdorben sind. Alleine die Tonnen von Brot, die täglich im Müll landen, nur weil wir um halb sechs noch frisch aufgebackenes Gebäck aller Sorten haben wollen. Am nächsten Tag ist das natürlich unverkäuflich.
Die Autorin gibt auch Einblicke in „nomad bases“, das sind Wohnungen und Häuser, die für jeden offen stehen. Hier ist man Gast und Gastgeber zugleich, alle tragen etwas bei. Diese Idee hat es schon in unsere Konsumwelt geschafft, natürlich etwas exquisiter. Wohnungstauschbörsen, wie AirBnb, sind hip, die ersten Hotels klagen schon über Umsatzrückgänge.
Was auch aus dieser Szene kommt und jetzt schon überall zu finden ist sind diverse Tauschbörsen, Gemeinschaftsgärten und Repaircafes, das alles gibt’s auch hier bei uns in Salzburg. Was ich sofort nachgegoogelt habe war die Idee der Earthships. Menschen bauen Häuser aus weggeworfenen Sachen und konstruieren sie so, dass sie energieautark sind. Wer meint, das müssten durchwegs windschiefe Hütten sein, der irrt. Manches dieser Häuser könnte einen Architekturpreis gewinnen: https://www.google.at/search?q=earthship&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=W4fzU4rsI-X5yQPd3oKYCA&ved=0CB0QsAQ&biw=1366&bih=581
Was Taubert unter anderem nach einem Jahr feststellt ist:
Im Konsumstreik habe ich gelernt, meine Sucht nach immer Neuem zu kanalisieren. Nach Dingen jenseits der Kaufhausregale zu fahnden, ist ein neues Hobby geworden…und… bei mir ist Do-it-Yourself nur als Do-it-Together möglich.
Empfehlenswert das Buch!