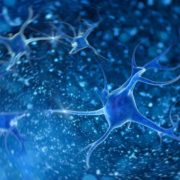Ein Gastbeitrag von Univ-Prof. Dr. Katharina J. Auer-Srnka
Wäre die aktuelle Debatte um die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit von Frauen ein Schulaufsatz, müsste man sie in weiten Teilen wohl schlichtweg als…
Archiv für das Jahr: 2017
20 Jahre habe ich mitarbeiten dürfen im Verein VIELE, ein Verein, der sich um die Integration von Frauen bemüht: damals noch Gastarbeiterinnen, dann Flüchtlingsfrauen vom Balkan, Frauen, die einen Österreicher geheiratet haben, Frauen, die in einer arrangierten Ehe leben. Analphabetinnen und Unilektorinnen. 20 Jahre durfte ich diesen Frauen die deutsche Sprache näher bringen und sie beratend ein Stück ihres Weges begleiten.
Die traditionellen Strukturen sind stark

2009 im Verein VIELE
Immer ging es darum, dass die Frauen den Spagat zwischen Herkunftskultur und dem Leben in Österreich schaffen mussten. Bei manchen ging es ganz leicht, andere mühten sich lange, viele zogen sich nach der Absolvierung des Deutschkurses in ihre Herkunftskultur zurück. Andere assimilierten sich, manche besannen sich noch stärker auf ihre Traditionen. Damals fiel es mir ganz leicht all diese Lebensentwürfe zu respektieren, ich zeigte Verständnis für traditionelle Lebensweisen mitten in Österreich. Oft erlebte ich, wie die Frauen unter dem Druck litten, vor allem die Erwartungen der Familie, mussten erfüllt werden. Mutter werden, die Familie zusammenhalten, arbeiten gehen, niemandem eine Schande machen.
Heute sehe ich die vielen Flüchtlingsfrauen und ich sehe die gleichen traditionellen Strukturen und Erwartungen an die Frauen. Und ich sehe in unserer Gesellschaft immer noch viel Verständnis, sensibles Herangehen, Begegnen auf Augenhöhe. Ich sehe auch das, was ich damals vor Jahren oft gemacht habe: zu wenig über die Werte und Erwartungen der österreichischen Gesellschaft zu sprechen und zu oft das Hinnehmen fremder Traditionen, die eigentlich nicht akzeptabel sind, weil sie dem Konzept von Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung und Säkularität unserer Gesellschaft widersprechen.
Ich bin jetzt ungeduldig
Heute will ich auch vieles nicht mehr akzeptieren, was ich etwa vor 15 Jahren noch gemacht hätte. Ich habe die Geduld nicht mehr. Und ich habe jetzt das Wissen, dass es schneller gehen kann. Indem wir unsere Erwartungen sagen und klar stellen, dass unsere Werte und Haltungen hier in Österreich für alle gelten und nicht verhandelbar sind.
Heute weiß ich, dass zu viel Rücksichtnahme, aber auch Wegschauen die Traditionellen stärkt und die Integration noch schwieriger macht. Das beginnt beim Kopftuch im Kindergarten, was ich absolut ablehne. Ich kann auch nicht akzeptieren, wenn Männer fordern, dass ihre Frauen keinen Kurs gemeinsam mit anderen Männern machen dürfen. Und eine Frau ist keine Hure, wenn sie nicht verheiratet ist und alleine ausgeht. Das will ich alles nicht mehr diskutieren müssen. Diese Geduld will ich nicht mehr aufbringen.
Ein Gastbeitrag von Dr. Elisabeth Adleff
Wann immer wir an einer körperlichen oder psychischen Erkrankung – wie z.B. Migräne, ADHS, Schlafstörung, Reizdarm, Neurodermitis, Depression etc. – leiden, so sind die vielfältigen Symptome dieser Erkrankung…
von Gudrun Kavalir
Musikkritiker Georg, Anfang 50, wird unter Hinweis auf notwendige Sparmaßnahmen gekündigt. Eine junge, unerfahrene Kollegin soll seinen Job übernehmen. Er verheimlicht seine Arbeitslosigkeit seiner Frau Johanna, Psychologin, die unbedingt ein Kind haben will. Die leeren Tage verbringt er im Wiener Prater, wo er seinen ehemaligen Schulkollegen Erich trifft, der ebenfalls arbeitslos ist. Gemeinsam mit dessen rumänischer Freundin Nicoletta nehmen sie eine ausrangierte „Wilde Maus“ wieder in Betrieb. Und Georg startet einen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Chef. Die Achterbahn seiner gescheiterten Existenz nimmt Fahrt auf.
Ist die WILDE MAUS ein typischer „Hader“? Nein. Er ist nämlich ganz anders als erwartet.
Man findet zwar den beißenden Humor, den Fatalismus und Zynismus der Figur des an sich selbst scheiternden Brenner wieder. Man erkennt auch die Stimme des grantelnden Kabarettisten Hader, der in seinen Programmen nie um eine Pointe verlegen ist, die ihn selber trotzig und rotzig dastehen lässt. Aber in der Wilden Maus ist alles anders. Und das ist gut so. Endlich kann Josef Hader zeigen, was er wirklich kann: Geschichten erzählen, die tief in die menschlichen Abgründe blicken lassen. Was er dort findet, bringt er schonungslos auf die Leinwand. Und das ist beim besten Willen nicht lustig.
Am Film „WILDE MAUS“ kommt bei uns derzeit niemand vorbei.
Den Film habe ich bereits in der ersten Woche nach seinem Start am 17.2. gesehen. Seither mehren sich die Gespräche mit Freunden und Bekannten. Sehr oft bin ich irritiert, dass viele den Film lustig finden: “Super Komödie!“, „Hab schon lang nicht mehr so gelacht!“, „So witzige Szenen!“. Wie bitte? Da war wohl jemand im falschen Film!
Es ist nicht witzig, wenn ein Mann im mittleren Alter seinen Job verliert und damit den einzigen Sinn in seinem Leben, das ohnehin nur aus bissigen Kommentaren und vernichtenden Urteilen über das Können oder Unvermögen anderer Menschen besteht. Wenn er Rache nimmt, und dafür zu drastischen Mitteln wie Sachbeschädigung und Aggression greift, ja selbst vor Mord nicht zurückschreckt.
Es ist nicht witzig, wenn ein Paar nicht mehr miteinander reden kann. Wenn die Kommunikation eingefroren ist. Wenn der Kritiker und die Psychologin keine Worte mehr haben, um ihre Beziehungskälte zu überwinden. Wenn man sich knappe Gemeinheiten an den Kopf wirft, damit der andere wenigstens irgendwas fühlt, und wenn es nur Verachtung ist.
Es ist nicht witzig, wenn die Achterbahnfahrt, die den ganzen Film dauert, Georg immer wieder dahin zurückbringt, wo er eingestiegen ist: zu sich selbst. Wenn er letztlich so verzweifelt ist, dass Selbstmord der einzige Ausweg zu sein scheint und auch dieser letzte Schritt scheitert.
Es ist tragisch und, ja, es kann auch komisch sein. Die „Wilde Maus“ ist daher sicher eines: eine pechschwarze Tragikkömödie im besten Sinn und ein großartiger, sehenswerter Film von Josef Hader, dem Regisseur.
Foto: © Petro Domenigg FILMSTILLS.AT
von Michael König
Es ist Dienstag abends. Zuhause angekommen, will ich mir mein IPad aus meinem Bürorucksack fischen. Nur: dort, wo ich es immer hineinstecke, ist es unauffindbar. Mein IPad ist weg. Natürlich muss ich es verlegt haben. Ich durchkämme alle Fächer meines Rucksacks. Ich streune bei den üblich verdächtigen Plätzen in meiner Wohnung herum. Bloß: Mein IPad ist nicht zu finden. Ich bin unrund. Also fahre ich kurzerhand ins Büro zurück. Ich werde mein IPad wohl dort vergessen haben. Aber auch in meinem Büro ist es nicht zu finden. Grawuzi. Wo habe ich das wohl angebaut?
Das Ipad fährt durch Salzburg
Am nächsten Morgen erinnere ich mich am Weg in die Arbeit, dass mir unser IT-Mann vor längerer Zeit doch etwas von einer Suchfunktion erzählt hat. Ich rufe ihn an. „Ja, kommen Sie zu mir ins Büro. Machen wir einen Versuch.“ Klick. Klick. Klick. Nach 15 sec erscheint am PC google map und siehe da: da zieht eine digitale Ameisenspur flink ihren Weg durch die Neutorstraße. „Da haben wir’s schon!“, lächelt unser IT-Mann zufrieden. „Ihr IPad fährt gerade durch die Neutorstraße!“ „Was, sind Sie sicher?“ „Na klar! Da schauen Sie, da fährt ihr IPad! Jetzt biegt es gerade in die Moosstraße ein.“. Ich schau ihn leicht verständnislos an. Und jetzt? Ich bin erstmal erleichtert. Mein IPad ist wieder da. Aber was um Himmels Willen treibt es um 08.00 Uhr morgens in der Moosstraße? Und mit wem? Meine Phantasien gehen mit mir durch. Was mache ich jetzt? Mein IT-Mann zuckt mit den Schultern. Ich rufe kurzerhand die Polizei an. Ich erkläre, dass mein IPad aus unerfindlichen Gründen gerade durch die Moosstraße fährt. Ohne mich. Unser IT-Mann macht zwischenzeitlich ein paar Screen-Shots, um den Morgenausflug meines IPads mitzudokumentieren.
Das IPad fährt Taxi
Die Geschichte interessiert jetzt auch die Polizei. Während ich auf eine Einsatzstreife warte, schießt es mir ein: Ich bin doch vorgestern Taxi gefahren. Könnte mir mein lausiges IPad da aus meinem Rucksack gesprungen sein? Ich rufe in der Taxizentrale an. „Ich suche mein IPad. Vielleicht ist es in einem ihrer Taxis unterwegs!“. „Ein was….?“ „Na, so eine Art digitales Jausenbrett, dünn, schwarz und mit Bildschirm“. Die Dame findet rasch heraus, mit welchem Taxi ich gefahren bin. Sie funkt das Auto an, während ich mit ihr telefoniere. Zeitgleich löst unser IT-Mann einen Alarm bei meinem IPad aus. Schöne neue digitale Welt. Gleich kriegen wir dich. Die Dame in der Zentrale hört durchs Telefon das vibrierende IPad. „Ja, Ihr Ixxxxx ist in diesem Taxi. Wir bringen es vorbei.“
Findet das IPad zurück?
Zwei Stunden später. Ich komme aus einem Meeting. Mein IPad ist noch immer nicht von seinem Ausreißversuch zurück. Erneut rufe ich in der Taxizentrale an. Nochmalige Rückfrage beim betreffenden Taxifahrer. „Nein, Ihr I…. ist da nicht.“. Mein IPad will also noch immer nicht zurück zu mir. Aber jetzt reichts mir. Nochmals hole ich unseren IT-Mann. Klick.klick.klick. Mein IPad ist nun in der Sterneckstraße unterwegs. Jetzt muss ich zu härterem Toback greifen. „Schauen Sie, wir verfolgen mein IPad hier am Bildschirm. Jetzt gerade fährt es durch die Sterneckstraße. Und wenn es nicht sofort zurückgebracht wird, dann werden wir es wohl mit Blaulicht zurückbringen lassen. Und siehe da. Das hat gewirkt. 20 min später kommt mein IPad schuldbewusst in seiner Gastlimosine von seinem 48-Stundenausflug zurück.

Mein IPad und ich, wir haben uns nach all der Aufregung ausgesprochen. Ich werde mit heutigem Tag seine Suchfunktion deaktivieren. Mein IPad darf sich künftig verloren gehen und hat mir im Gegenzug versprochen, mir nie mehr aus meinem Rucksack zu springen. Dieser Ausflug hat wirklich außer Stress nichts gebracht. Doch. Er hat mich um eine Erkenntnis reicher gemacht. Meine diversen elektronischen Begleiter funken Tag und Nacht meine digitalen Spuren in diverse Clouds und auf irgendwelche Server. Ständig. Pausenlos. Theoretisch weiß ich das natürlich nicht erst seit dem Ausreißversuch meines IPad.
Die Fastenzeit ist ein gute Zeit, diese üppigen Spuren zu reduzieren. Ich erinnere mich: Vor einiger Zeit nahm ich im Zuge einer Diskussion über die sogenannten „elektronischen Fußbänder“ für an Demenz erkrankte Menschen den Standpunkt ein: So was würde ich für mich nie haben wollen. Das Recht, verloren gehen zu dürfen, lass ich mir nicht nehmen. Auch nicht im Alter. Und erst recht nicht in meinem ganz normalen, aktuellen Leben. Ich werde mich selbst ernstnehmen. Ich will mich im ganz normalen Leben nicht wie auf einer Intensivstation fühlen, wo ein ständiger Datentropf meine Lebensspuren aufzeichnet. Diskutiere ich diese Geschichte mit Menschen der Generation Y, ernte ich nur ein Schulterzucken. Es scheint ihnen egal zu sein, wer in ihrem Leben mitliest. Tatsächlich oder potentiell. Mir ist es nicht egal. Vielleicht definieren die Menschen der Y-Generation Freiheit anders als ich. Mag sein.
Ich und mein IPad, wir sind jedenfalls um eine Erfahrung reicher. Und wir sind froh, wieder zusammen zu sein.
Ein Schnupperkurs ist ja dazu da, etwas Neues kennen zu lernen. Beim Schnupperkurs „Fliegenfischen für Frauen“ hat Franz Xaver Ortner auch Einblicke ins Fliegenbinden gegeben.
Seit 35 Jahren hat Franz Xaver eine große Leidenschaft – das Binden von Fliegen. Und wenn man ihm so zuschaut, sieht und spürt man sofort, dass er der Herr der Fliegen. Er gehört zur Weltspitze, seine Expertise ist überall gefragt. Das führt ihn auch zu den schönsten Gewässern der Welt, aber in Salzburg ist er zu Hause. Beim Fischereiverein Salzburg wirft er seine Fliegen in der Salzach aus, das Revier des Vereins reicht von der Staatsbrücke bis nach Urstein.
Beim Fliegenfischen geht es den meisten Fischen nicht an den Kragen. Der Köder hängt an der Angel ohne Widerhaken, damit wollen die Fischer verhindern, dass die Fische verletzt ins Wasser zurückkommen.
Beim Schnupperkurs zeigt uns Franz Xaver, wie man eine Fliege bindet. Sein persönlicher Rekord liegt bei 1 Minute und 36 Sekunden, natürlich auch mit geschlossenen Augen. Eine gute Fliege um die zwei Euro. Wenn es naturalistisch sein sollte, steigt der Preis schon mal auf gut 20 Euro.

Die Fliege „Fast Food“ entsteht

Frisch geölt kann „Fast Food“ in den Einsatz
Fasziniert schauen alle zu, wie er die Fliege „Fast Food“ bindet. Blitzschnell ist der orange Rumpf gebunden, dann kommt der Rest der Fliege dran.

Franz Xaver zeigt wie es geht: Das Auswerfen der Angel
Aber er ist beim Kurs nicht nur fürs Fliegenbinden da, er zeigt den Frauen auch, wie man die Angel richtig auswirft. Und wenn man so zuschaut, weiß man, warum Fischen so beliebt ist. Es gibt keinen Stress, alles verläuft ruhig. Franz Xaver wirft die Angel so aus wie er Fliegen bindet: Die Handgriffe sitzen, nichts ist hektisch.
Wer hat jetzt Lust auf Fliegenfischen?
Jan Kubala und Herwig Geroldinger vom Fischereiverein Salzburg freuen sich über neue Mitglieder

Bernhard Nisslmüller weiß vieles über das Fliegenfischen zu erzählen
Interessante Links
Hier findest Du ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Website :)Seiten
Kategorien
- Allgemein
- Altern- Lust und Frust!
- Arbeit
- Augenblicke
- Entertainment
- Europa
- Film & Kino
- Frisch aus dem Garten
- Gegacker vom Hühnerhof
- Geschichte
- Gesellschaft
- Gesellschaftspolitik
- Gruß aus der Küche
- Hacker am Ball!
- Hundiversum
- Kolumne
- Kultur
- Leben
- Literatur
- Mamamia
- Menschenrechte
- Miteinander
- Mobilität
- Neues vom Lieblingsplaneten
- Papalapapp
- Salzburg
- Spirituell
- Sport
- Vorgestellt
- Welt
- Wirtschaft
- Wissenschaft
Archiv
- Oktober 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012