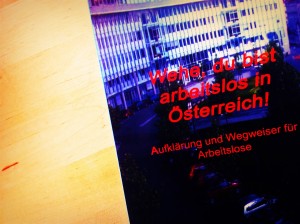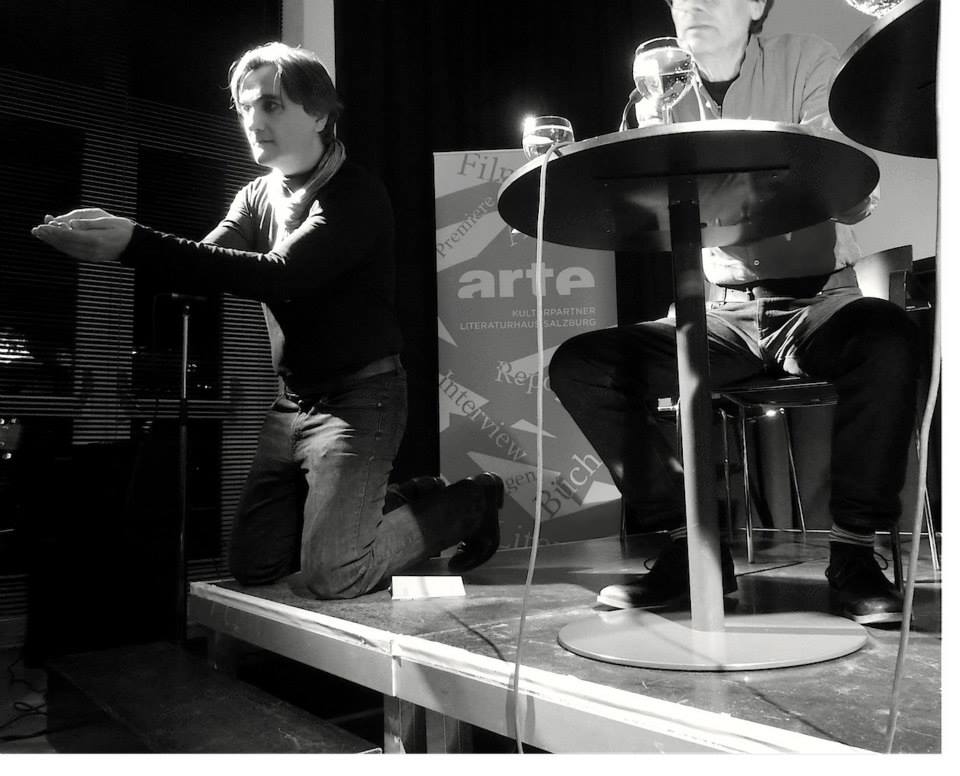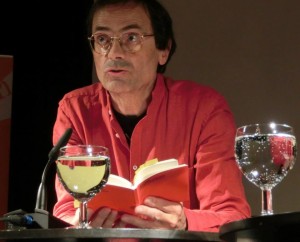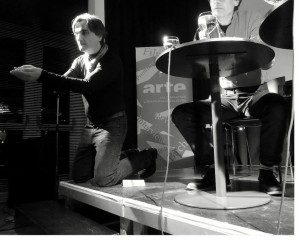Ein Beitrag von Monika Rattey
Grau ist die Straße in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs. Keine bunt herausgeputzten Barockbauten für aufgeregt herumwuselnde Touristen, die täglich in Reisebusgrößen aus allen Teilen der Welt in die Altstadt kommen, sondern unscheinbare Vor- und Nachkriegsbauten säumen die Plainstraße. Es ertönt kein helles, fröhliches Gebimmel vom Glockenspiel-Turm auf dem Salzburg Museum. Nein, hier zischt und rauscht es in den Ohren, wenn der ICE langsam auf Touren kommt und auf dem Weg von Wien nach München beschleunigt.
Es ist Mittwoch, 14.00 Uhr, und eine lange Traube von Menschen sammelt sich um das Haus Nummer Zwei in der Plainstraße, ganz ähnlich wie vor Mozarts Geburtshaus. Aber hier sprechen die Menschen eine andere Sprache nicht jene der Touristen in Salzburgs Altstadt. Sie sprechen deutsch, serbokroatisch, bosnisch oder türkisch. Manchmal auch yoruba, vietnamesisch, bulgarisch, mongolisch oder arabisch. Sie stehen Schlange. Sie warten darauf, dass sich endlich die Tür zum SOMA (Sozialmarkt) öffnet.
Es reicht net aus
In der Reihe steht auch die 82-jährige Theresia G. Gebückt, vom Alter gezeichnet, hält sie sich mit ihren zittrigen Händen an ihrem Rollator fest und wartet wie die anderen mit blasser, geduldiger Miene. Es ist soweit, die Ladentür öffnet sich und die Menschen strömen in das Geschäft. Frau G. schiebt sich auf ihren wackeligen Beinen langsam hinterdrein.
„I kauf hier einmal die Woche ein, weil’s billig is, und i mir sunst nix leisten kann“, sagt die Salzburger Pensionistin aus Itzling, die erzählt, dass sie mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung, das sind für den Lebensunterhalt 596,18 Euro und fürs Wohnen 380 Euro auskommen muss. Davon gehen für die Miete und Betriebskosten ihrer 50-Quadratmeter-Wohnung allein 450 Euro weg. „Was bleibt, reicht net aus, um im Supermarkt ums Eck einz`kaufen“, so die alte Dame.
Im Sozialmarkt in der Elisabeth-Vorstadt darf nicht jeder einkaufen. Es ist ein Lebensmittelmarkt für Menschen mit geringem Einkommen. Die Kunden müssen vor dem ersten Einkauf darüber einen Nachweis den Mitarbeitern des Geschäftes vorlegen. Dann erhalten sie eine Einkaufskarte, mit der sie dort jeweils am Montag, Mittwoch oder Freitag, von 14.00 bis 17.00 Uhr günstig Lebensmittel einkaufen können. Die Waren werden nicht kostenlos an bedürftige Menschen abgegeben, sondern zu einem fairen Preis. Durch die Ersparnis beim Einkauf im Sozialmarkt, werden Mittel frei, sodass anderweitig etwas Nötiges gekauft werden kann.
50 Freiwillige engagieren sich
Die alte Dame hat heute ihre Lebensmittelkarte in ihrer Zweizimmerwohnung vergessen, doch Georg Steinitz, Obmann vom SOMA kennt sie bereits und grüßt sie freundlich: „Grüß sie Frau G., i schick gleich meine Kollegin, die wird ihnen helfen“, sagt Steinitz, der den SOMA vor elf Jahren mitgegründet hat und dort seither wie 50 andere Freiwillige ehrenamtlich tätig ist und er ist stolz darauf: „Wir sind der einzige Sozialmarkt in Österreich, der sich alleine – ohne Subventionen durch die öffentliche Hand trägt und alleine durch ehrenamtliche Hilfe ermöglicht wird.“
Frau G. kramt in ihrem dunkelgrauen Lodenmantel nach dem Einkaufszettel: „Heut bräucht i Joghurt, Butter, Nudeln. Da Kaffee is ma a ausgangen. Habens vielleicht wieder einen kriegt?“ Die ehrenamtliche Mitarbeiterin ist schon zur Stelle, muss die Seniorin jedoch vertrösten: „Heute haben wir leider keinen Kaffee, aber am Freitag soll eine Lieferung kommen.“
Im Sozialmarkt ist nicht immer alles parat. Dieser wird von verschiedenen Firmen, wie etwa Recheis, Hipp, Efko, Inzersdorfer oder Pfanner und einigen mehr gratis beliefert. Die Produkte, die falsch etikettiert wurden, kurz vor dem Ablaufdatum stehen, oder aus dem Verkaufssortiment genommen wurden, werden dem SOMA geschenkt. Es kann dann schon mal passieren, dass sich Paletten mit Essig-Kombucha Getränken stapeln, oder Zitronenteegranulat in der Größe eines Kleinlieferwagens im rund 60 Quadratmeter großen Geschäftsraum untergebracht werden muss. „Aber die Menschen sind dankbar für alles und wir werden auch das ganze Sortiment los“, erklärt die SOMA-Mitarbeiterin und durchsucht aufmerksam das Kühlregal nach den Milchprodukten für Frau G.
Auf der Kühlregalleiste sind die Preise verzeichnet: vier Becher Bio-Joghurt von der Firma Alpro kosten 30 Cent, ein viertel Kilo Butter auch nur 30 Cent. In den Regalen daneben ist heute Machland Apfelmus um 20 Cent pro Viertelglas zu haben. Die Packung Tortellini von Barilla gibt’s um 40 Cent. Und das Schwarzbrot vom Bäcker Ketter ist heute gratis, weil es gestern abgelaufen ist.
Aber der Andrang ist groß und Frau G. kann gerade noch ein viertel Kilo Brot ergattern. Denn durchschnittlich 100 Menschen aus der Stadt Salzburg aber auch aus dem Umland kaufen in den drei Stunden, in denen das Geschäft offen hat, ein. Insgesamt sind es 1.200 Menschen, die eine Einkaufskarte des SOMA besitzen.
Viele Jüngere schämen sich
„Nach einer neuester Erhebung sind in Salzburg fast 13 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, sie leben also unter der Armutsgrenze“, erklärt Robert Buggler, Leiter der Salzburger Armutskonferenz. „In absoluten Zahlen sind das 66.000 Menschen; das ist rund jede beziehungsweise jeder Achte“, so Buggler.
„Nicht nur Mindestrentnerinnen und -rentner sind darunter, auch viele Alleinerzieherinnen mit Kindern. 60 Prozent der Kunden kommen aus anderen Ländern, hauptsächlich aus Ex-Jugoslawien und der Türkei. Sogar ausländische Studenten aus der Mongolei oder Flüchtlinge aus Nordkorea kaufen hier billig ein“, erklärt Steinitz.
Viele Österreicher, besonders Jüngere würden sich jedoch nach wie vor schämen in einem Sozialmarkt einzukaufen, obwohl laut Steinitz, in den letzten Jahren ein Anstieg an Bedürftigkeit auch unter Jüngeren zu bemerken war.
Frau G. hingegen schämt sich ihres Einkommens nicht: „I kauf hier ein, weil i mir was von meiner klanen Rente zammsparen kann, des Leben is einfach z` teuer und i hab schon zu viel erlebt, als dass i mi schämen müsst.“ Sie wackelt, den Rollator vor sich hinschiebend, zur Kasse, sucht ihr Geldbörsel und zahlt ihren Einkauf. Ein viertel Kilo Butter, ein Glas Marmelade, vier Joghurt, zwei Packungen Tortellini, ein Apfelmus und ein Packerl Sauerkraut und zahlt 1,70 Euro. „Des Brot zahl i ah noch“, meint sie bestimmend.
„Nein Frau G.“, antwortet die Mitarbeiterin von SOMA, „das brauchen s` nicht. Das Brot ist heute gratis.“
INFOBOX:
Im Land Salzburg gibt es an insgesamt vier Standorten Sozialmärkte, in der Stadt Salzburg, Hallein, in St. Johann im Pongau und in Zell am See. Zusätzlich wird im Pinzgau ein mobiler Sozialmarkt angeboten. Weitere Informationen und Öffnungszeiten auf der Website der Laube GmbH. Die Laube GmbH ist Träger der Sozialmärkte in den Bezirken. In der Stadt Salzburg betreibt der Verein SOMA den Sozialmarkt. Informationen dazu unter der Website vom SOMA Salzburg Stadt.
Die Sozialmärkte suchen laufend Firmen, die ihre Lebensmittel und Produkte, statt diese teuer zu entsorgen, zur Verfügung stellen und damit soziales Handeln beweisen. Vor allem Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel oder Waschmittel werden benötigt.