 Ein Beitrag von Harald Saller:
Ein Beitrag von Harald Saller:
Gewisse Tage im Leben vergisst man nicht. Einer davon ist der 30. April 1994. Es ist ein herrlicher Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen. Ich bin an diesem Nachmittag mit Schulkollegen bei einem Fußballspiel, als plötzlich ein junger Mann zu uns kommt und sagt: „Habt ihr schon gehört, da Ratzenberger ist tödlich verunglückt!“ Geschockt von dieser Meldung schwinge ich mich auf mein Fahrrad, fahre nach Hause und drehe Fernseher und Radio auf. Nach einiger Zeit kommt tatsächlich die Meldung, dass Salzburgs erster und zugleich einziger Formel-1-Fahrer im Qualifying zum Großen Preis von Imola tödlich verunglückt ist. Der 33-Jährige war mit seinem Boliden bei rund 300 km/h aufgrund eines Bruchs des Frontflügels von der Strecke abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Ratzenberger hatte keine Chance zu überleben. Es sollte eines der schwärzesten Formel-1-Wochenenden der Geschichte werden. Nur einen Tag später kommt der dreifache brasilianische Weltmeister Ayrton Senna ums Leben.
Heute jährt sich der Todestag von Roland Ratzenberger zum 20. Mal. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Als er starb, war ich erst 13 Jahre alt. Als jemand, der ebenfalls seit frühester Kindheit vom Motorsport fasziniert war, habe ich seine Karriere via Fernsehen, Magazine und Zeitungen verfolgt. Ich habe Bücher gewälzt und später im Internet Videos von früher angesehen. Der stets auf Vollgas getrimmte Rennfahrer machte den Eindruck eines stattlichen Mannes, der mit seiner charismatischen Persönlichkeit jeglichen Raum ausfüllt und obendrein genau weiß, was er will.
Ich habe den traurigen Anlass genutzt und die Eltern von Roland Ratzenberger besucht, um über das Geschehene zu sprechen. Sein Vater Rudolf und seine Mutter Margit leben in der Wohnung in Salzburg-Maxglan, die ihr Sohn eine Woche vor seinem Tod gekauft hatte. Roland ist noch immer allgegenwärtig.
 Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.
Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.
Als Roland Ratzenberger, der im Salzburger Stadtteil Gnigl aufgewachsen ist, seinen Eltern sagt, dass er Rennfahrer werden wolle, sind diese alles andere als begeistert. „Ich wollte eigentlich, dass er die HTL absolviert und einen technischen Beruf erlernt. Leider musste er in der vierten Klasse die Schule verlassen“, so der Vater. Der Junior habe sich aber ohnehin nicht von seiner Idee abbringen lassen. „Er war sehr ehrgeizig, zielstrebig und vor allem geschäftstüchtig. Er wollte sich von uns gar nicht helfen lassen.“
Roland arbeitet unter anderem als Instruktor und Mechaniker in der Rennfahrerschule von Walter Lechner. „Er schraubte oft bis zum Umfallen. Er nahm sich nicht Mal die Zeit, etwas Vernünftiges zu essen“, so der Senior. In Italien schult er Bodyguards von reichen Leuten, wie man den Wagen in Grenzsituationen beherrscht. Mit dem verdienten Geld finanziert er sich seine Karriere als Rennfahrer.
1980 macht er das erste Mal auf sich aufmerksam. Der damals 20-Jährige gewinnt die „Jim Russel Trophy“. Drei Jahre später folgt der erste Sieg in der Formel Ford auf dem Nürburgring. 1986 gewinnt er als bisher einziger deutschsprachiger Rennfahrer beim Formel-Ford-Festival im englischen Brands Hatch. Seine Eltern sowie seine zwei Schwestern verfolgen das Geschehen von Salzburg aus. „Ich war nur bei einem Rennen in der Formel Ford Mitte der 80er dabei.“, erinnert sich Vater Rudolf.
1989 erfolgt der nächste Karriereschub. Roland Ratzenberger wird der erste europäische Werksfahrer bei Toyota. Er pendelt zwischen Japan und Europa, fährt zahlreiche Rennen in der Formel 3000, in der Gruppe A und C und zusätzlich für BMW im Tourenwagensport. In einer japanischen Bar kommt es zu einer brenzligen Situation. Ein Mann bedroht Ratzenbergers deutschen Rennfahrerkollegen Heinz-Harald Frentzen mit dem Messer. Roland schiebt sich mutig dazwischen und entschärft die gefährliche Angelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt verdient er bereits gutes Geld und kann ein feines Leben führen. Er kauft sich einen Porsche 911 Carrera, von dem er immer geträumt hatte.
Seinen großen Plan von der Formel-1-Karriere hat er damals schon fast aufgegeben, schließlich ist er bereits über 30 Jahre alt. Durch seine Geschäftstüchtigkeit kommt er mit Barbara Behlau in Kontakt. Die Inhaberin einer Kultur- und Sportagentur in Monaco finanziert ihm den Formel-1-Einstieg beim englischen Team Simtek – vorerst für fünf Rennen für die Saison 1994. Im unterlegenen Wagen des britischen Rennstalls verpasst er die Qualifikation für das Rennen im brasilianischen Interlagos. Beim zweiten Rennen im japanischen Aida schafft Ratzenberger den Sprung ins Starterfeld. Er wird schlussendlich Elfter.
Das dritte Rennen findet in Imola in San Marino statt, die fatalen Ereignisse nehmen ihren Lauf. „Ich habe mich immer damit getröstet, dass Roland bei dem gestorben ist, was er am liebsten gemacht hat. Meine Frau hat das Ganze mehr mitgenommen“, sagt Vater Rudolf, der sich bei unserer Verabschiedung für mein Kommen und der Anteilnahme bedankt.
Ironie des Schicksals: Auf dem Toyota, mit dem Roland Ratzenberger bei den 24 Stunden von Le Mans hätte starten sollen, steht noch sein Name. Ersatzfahrer ist der Amerikaner Jeff Krosnoff. Er wird Zweiter beim Langstrecken-Klassiker, verunglückt aber nur zwei Jahre später bei einem Rennen zur Indycar-Serie in Toronto ebenfalls tödlich.
 Ich liebe Minze. Sie ist erfrischend, das Öl hilft bei Kopfschmerzen und ein Tee aus frischer Minze an einem heißen Sommertag ist besser als jedes Kaltgetränk. Was ich an der Minze noch so schätze ist ihre Wuchsfreudigkeit. Einmal im Garten gepflanzt ist sie nicht mehr weg zu bringen. Sie taucht an den verschiedensten Stellen auf. Nicht unbedingt zur Freude aller, mir gefällt das allerdings, wenn die Minze wieder mal irgendwo auftaucht aus der Erde. Jetzt ist die beste Zeit, um vor der Blüte, die frischen Blätter zu pflücken und Minzsirup zu machen. Die Blätter sind jetzt besonders aromatisch und das gibt einen tollen Sirup.
Ich liebe Minze. Sie ist erfrischend, das Öl hilft bei Kopfschmerzen und ein Tee aus frischer Minze an einem heißen Sommertag ist besser als jedes Kaltgetränk. Was ich an der Minze noch so schätze ist ihre Wuchsfreudigkeit. Einmal im Garten gepflanzt ist sie nicht mehr weg zu bringen. Sie taucht an den verschiedensten Stellen auf. Nicht unbedingt zur Freude aller, mir gefällt das allerdings, wenn die Minze wieder mal irgendwo auftaucht aus der Erde. Jetzt ist die beste Zeit, um vor der Blüte, die frischen Blätter zu pflücken und Minzsirup zu machen. Die Blätter sind jetzt besonders aromatisch und das gibt einen tollen Sirup.








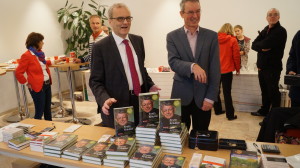






 Für andere VerkehrsteilnehmerInnen stellen FußgängerInnen dagegen häufig einen unkalkulierbaren und deshalb unangenehmen Faktor dar. Vielleicht weil man sich nicht mit ihnen identifizieren kann oder möchte. In der Regel hat man sich zu Fuß mit den anderen zu identifizieren. Natürlich achtet jemand beim Queren der Straße erst genau, ob ein Auto kommt und nicht umgekehrt der/die AutofahrerIn, ob jemand die Fahrbahn queren möchte. Aber ist hier nicht etwas verdreht?
Für andere VerkehrsteilnehmerInnen stellen FußgängerInnen dagegen häufig einen unkalkulierbaren und deshalb unangenehmen Faktor dar. Vielleicht weil man sich nicht mit ihnen identifizieren kann oder möchte. In der Regel hat man sich zu Fuß mit den anderen zu identifizieren. Natürlich achtet jemand beim Queren der Straße erst genau, ob ein Auto kommt und nicht umgekehrt der/die AutofahrerIn, ob jemand die Fahrbahn queren möchte. Aber ist hier nicht etwas verdreht?




 Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.
Fotos, Pokale und Modelle seiner Rennwagen zieren das Wohnzimmer. „Roland lebt noch immer bei uns mit“, sagt sein Vater. Der heute 81-Jährige hat Stress, wie er sagt. Zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland rufen ihn an, um über seinen Sohn zu berichten. „Ich spreche gerne mit den Journalisten. Für mich ist das eine Art der Trauerbewältigung.“ Er und seine Frau besuchen regelmäßig das Grab auf dem Maxglaner Friedhof, das nach wie vor Fans aus der ganzen Welt besuchen und schmücken. „Ein Mal ist ein ganzer Bus mit Japanern zu uns gekommen. Das war eine herzliche Angelegenheit“, sagt Vater Rudolf und lächelt. Seine Worte klingen so lebendig, dass man den Eindruck gewinnt, Roland würde jederzeit bei der Tür hereinspazieren.