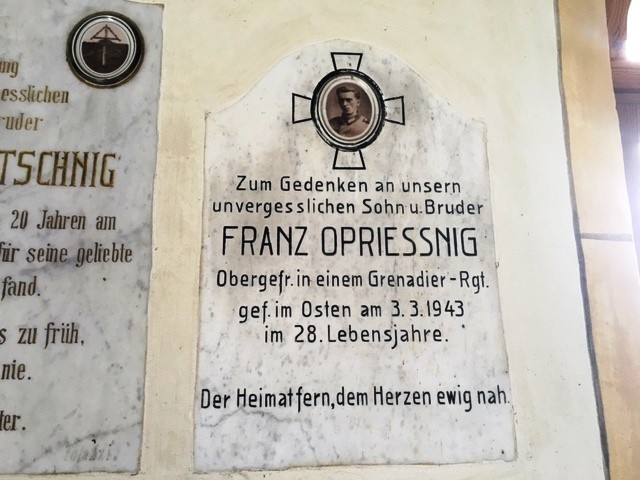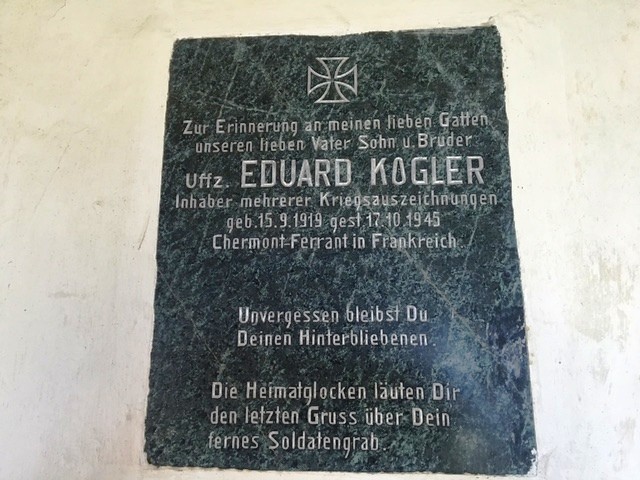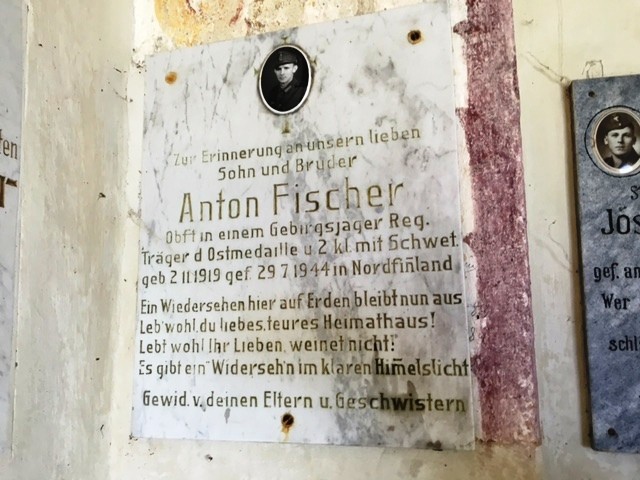von Nedžad Moćević
Es vergeht beinahe kein Tag, ohne dass ich an diesen gebrechlichen, alten Mann denke, wie er von zwei Sympathisanten des IS gedemütigt und ermordet wird. Teil meiner Arbeit ist es zu verstehen warum Menschen so etwas tun, darum soll es hier in erster Linie jedoch nicht gehen. Diese Schreckenstat warf in mir aufs Neue die Frage auf, wie um alles in der Welt man das „im Namen des Islams“ und in Berufung auf die „islamische Tradition“ ausführen konnte. Dabei musste ich insbesondere an folgende Erzählung denken:
Ein Kalif mit großem Respekt vor dem Christentum
Der Geschichtsschreiber Ibn Khaldun (1332-1406) überliefert folgende Begebenheit: als Omar, der zweite Kalif (Nachfolger Muhammads), im Jahr 638 Jerusalem eroberte, bot ihm der Patriarch (christliches Oberhaupt) von Jerusalem einen Stadtrundgang an. Als die Zeit zum Gebet kam, machte der Patriarch den Kalifen das Angebot in der Grabeskirche Jesu zu beten. Omar lehnte ab mit folgender Begründung: „Wenn ich in der Kirche beten würde, würden es vielleicht die Muslime zur Moschee machen.“ Seine Sorge war es, dass die MuslimInnen nicht zu späterer Zeit Anspruch auf das Gebetshaus erheben, weil der Kalif dort einst betete.
Omar gab außerdem folgendes Versprechen den ChristInnen von Jerusalem: „Das ist die Sicherheitsgarantie, die der Diener Gottes, Omar (…) den Menschen von Jerusalem gegeben hat. Er gewährt ihnen Sicherheit für ihr Leben, ihren Besitz, ihre Kirchen, ihre Kinder, die Kranken und Gesunden der Stadt (…). Ihre Kirchen dürfen nicht beschlagnahmt, zerstört, entheiligt oder entwürdigt werden – das Gleiche gilt für ihre Kreuze und ihr Geld. Sie dürfen weder gezwungen werden ihre Religion zu verändern noch darf keinem von ihnen Schaden zugefügt werden.“
Frieden zwischen den Religionen? Unerwünscht?
Mir geht es hierbei nicht alles schön zu reden und zu behaupten, dass diese Zeiten nur von Toleranz und Respekt geprägt waren aber auf solche Worte zu Beginn des sogenannten „dunklen“ Mittelalters zu stoßen, versetzen einen durchaus in Staunen.
Heute, mehr als tausend Jahre später, sind wir Zeugen eines anderen „Kalifen“, der sich auf den oberen beruft: Abu Bakr al-Baghdadi beansprucht der neue „Führer der Gläubigen“ zu sein und ruft die MuslimInnen weltweit auf sich ihm anzuschließen. In Vergleich zu ihm wirkt sein mittelalterliches Vorbild geradezu modern.
Hier wird deutlich, dass es bei der Ermordung des Pfarrers in Wirklichkeit auch gar nicht um Religion oder irgendeine Tradition geht. Der Terrorismus versucht nämlich zurzeit den eigenen Zorn und Hass zu exportieren. Er will uns verführen uns gegenseitig zu hassen, indem TerroristInnen Identifikations-Figuren wie zB. Pfarrer Jacques Hamel demütigen und töten. Seine Mörder sind sich dessen völlig bewusst, dass, wenn ein Pfarrer getötet wird, nicht nur die übliche Angst verbreitet wird, sondern Menschen, die sich mit diesem Pfarrer identifizieren (sprich ChristInnen), gekränkt und zum Kampf provoziert werden sollen. Im Gegenzug sollen sich wiederum MuslimInnen angegriffen fühlen und „gebacken“ ist der Religionskrieg. Der IS bezeichnet diese Strategie als die Zerstörung der „grauen Zonen“. Gemeint sind die „Zonen“, in denen MuslimInnen in Frieden mit anderen Menschen leben.
Mein Appell: tun wir den Mördern von Pfarrer Jacques nicht diesen Gefallen.
MuslimInnen und ChristInnen sind nicht im Krieg! Keiner ist des anderen Feind, nur weil man eine andere Religion oder Weltanschauung hat. Unsere Feinde sind ExtremistInnen auf allen Seiten, die uns genau das versuchen einzureden und von den eigentlichen Problemen auf der Welt ablenken: Ausbeutung, Umweltverschmutzung, 1% der Menschheit besitzt so viel wie die restlichen 99% etc. Und dafür sind weder „der“ Islam noch „das“ Christentum schuld. Meine Oma wurde im Bosnienkrieg (1992-1995) von einem katholischen, kroatischen Scharfschützen erschossen – ich sehe mich jedoch in keinster Weise im Krieg, weder mit KroatInnen noch mit KatholikInnen, sondern wie gesagt mit FanatikerInnen, egal welcher Art.

Nedzad Mocevic
Die Revolution des Miteinanders
Die Antwort auf Terror muss eine Revolution sein. Keine Revolution, bei der Köpfe rollen, sondern eine Revolution des Miteinanders, Dialogs, Vertrauens und Abbauens von Ängsten.
Jede/r von uns hat NachbarInnen, ArbeitskollegInnen oder MitschülerInnen, die einer anderen Religion oder Weltanschauung angehören. Nun ist die Zeit gekommen sie einzuladen und nicht mehr teilnahmslos oder lächelnd aneinander vorbei zu spazieren. Nicht mehr einfach herum zu jammern, dass „alles nur noch schlimmer wird“ oder dass „die anderen auch nichts tun“. Dieses Gerede nützt niemandem! Gehen wir aufeinander zu und reden wir offen über unsere Ängste, Probleme, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und auch wenn man nicht mit allen in allem einer Meinung sein wird – was solls, mit wem bin ich das schon?
Wir müssen außerdem gemeinsam gegen Unterdrückung und Unrecht vorgehen im Namen von wem auch immer! Es kann und darf nicht sein, dass nur MuslimInnen die Unterdrückung von MuslimInnen beklagen, nur ChristInnen die Unterdrückung der ChristInnen erkennen, dass nur Frauen „FeministInnen“ sind und nur Schwarze „Black Lives Matter“ rufen. Dies wird uns helfen uns unabhängig von unseren Unterschieden zu organisieren und uns erkennen lassen, dass wir am Ende das Gleiche wollen: ein würdevolles Dasein.
Der muslimische Gelehrte Ibn Hazm al-Andalusi (994-1064) schrieb bereits im mittelalterlichen Spanien passend dazu:
„Vertraue einem Gläubigen, auch wenn er nicht von deiner Religion ist und verlasse dich auf keinen Fall auf einen leichtsinnigen Menschen, auch wenn er ein Anhänger deiner Religion ist.“