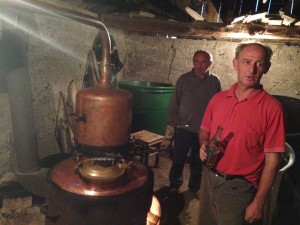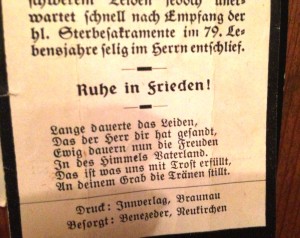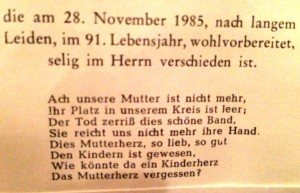Domagoj Borosak, 42, lebt in Zagreb und arbeitet als Dolmetscher. Er spricht und versteht Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Ungarisch, Italienisch, Türkisch, Slowenisch, Mazedonisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Tschechisch und Slowakisch.
Wir treffen ihn in Zagreb, das Interview führen wir in Deutsch.
Zartbitter: Ich bin total beeindruckt von deiner Vielsprachigkeit. Wie hast du so viele Sprachen gelernt?
Domagoj: Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Ein bisschen Talent ist auch dabei. Aber vor allem bin ich neugierig. Ich hatte schon als Kind großes Interesse an Sprachen.
Zartbitter: Was interessiert dich an Sprachen?
Domagoj: Als Kind wollte ich immer wissen, was die Leute reden, die ich nicht verstanden habe. Das hat mich angespornt. Erst später habe ich mich mit Sprachstrukturen und Linguistik beschäftigt.
Zartbitter: Welche Sprache war leicht für dich zu lernen, welche besonders schwierig?
Domagoj: Am leichtesten lernt es sich als Kind. Und natürlich die Sprachen, die miteinander verwandt sind. Englisch zum Beispiel mag ich nicht so besonders, also ist es für mich schwieriger. Man muss es können, es ist eine Weltsprache, aber es interessiert mich nicht so. Schwierig sind die nicht-indogermanischen Sprachen wie Türkisch und Arabisch.
Zartbitter: Hast du Lieblingswörter in jeder Sprache?
Domagoj: Eigentlich nicht. Die Sprache als Gesamtes ist schön. Ja doch, ich mag die Wörter aus dem Türkischen, die wir hier am Balkan benutzen.
Zartbitter: Du kannst sicher auch die Schimpfwörter in jeder Sprache. Gibt es da Unterschiede?
Domagoj: Ja, ich kenne viele. Die meisten in den südslawischen Sprachen. Die Schimpfwörter werden hier von allen benutzt vom Fleischer bis zum Doktor. Man kann sich ernsthaft beleidigen, das machen auch zwei Omas untereinander. Es gibt so viele Varianten, dass es auch schwierig ist sie in eine andere Sprache richtig zu übersetzen.
Zartbitter: Kann dich bei Sprachen noch etwas überraschen?
Domagoj: Es gibt immer wieder grammatische Strukturen, die man neu entdecken kann. Das ist endlos, ein weites Feld.
Zartbitter: Es gibt Menschen, die eine neue Sprache lernen müssen, aber eigentlich nicht wollen. Was kannst du ihnen empfehlen, damit es ein bisschen Spaß macht?
Domagoj: Egal welche Sprache, das Wichtigste ist reden, reden, reden! Lehrbücher, Lehrer sind nicht so wichtig. Man kann 100 Mal einen Fehler machen, irgendwann macht man es richtig. Die meisten haben Angst vor Fehlern. Man sollte auch Zeit in dem Land verbringen, dessen Sprache man lernt. Und schüchterne Menschen haben es schwerer, offene Menschen tun sich leichter. Ich lese auch sehr viele einfache Texte, schaue Werbespots und höre Lieder, so bleibt die Sprache im Ohr.
Zartbitter: Danke Domagoj für das Gespräch und viel Freude beim Erlernen der nächsten Sprachen.