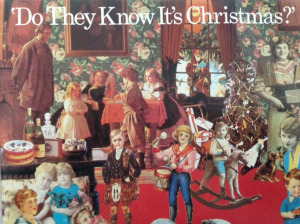Horrorfilme sind blöd. Das höre ich oft. Und wenn ich die Horrorfilme der letzten Jahre ansehe, dann stimmt eines: Es ist um dieses Genre gar nicht gut bestellt. Es werden zu viele billige 0815-Filme gemacht. Wie viele Fortsetzungen von „Paranormal Activity“ gibt es jetzt schon?
Dieser Blogpost ist für alle, die sich durch Horror intellektuell beleidigt fühlen oder Horrorfilme nicht ansehen, weil sie keine Geschichten mögen, „die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben“. Ja, auch dieses Argument höre ich öfter.
Manchmal muss man sich aber auch nur ein wenig mit dem Film auseinandersetzen, um zu sehen, welche Geschichte er tatsächlich erzählt.
Der australische Film „The Babadook“ ist hier ein gutes Beispiel. Er läuft derzeit in Großbritannien und den USA und bekommt einiges Kritikerlob. Beim Publikum kommt er jedoch nicht so gut an. „Zu wenige Schreckmomente und man muss bis zum Schluss warten, bis man das Monster endlich ein bisschen sieht“, so viele Reaktionen auf IMDB.
Warum ist „The Babadook“ nicht so produziert, dass er genau diese Erwartungen erfüllt? Weil es in Wahrheit gar kein Monster gibt. Die Geschichte ist nämlich eine ganz andere.
Wie ich die Handlung verstanden habe
(Achtung Spoiler – und gleichzeitig irgendwie doch keine Spoiler, weil der Film die Handlung in anderen Bildern zeigt.)
Amelia ist die Mutter des kleinen Sam, dessen Vater am Tag seiner Geburt starb. Amelia hat den Tod ihres Mannes über Jahre nicht verarbeitet. Kurz vor seinem siebten Geburtstag hört Sam nicht auf, von Monstern zu reden und davon, wie er seine Mutter vor ihnen beschützen wird. Dafür bastelt er sich ziemlich ausgeklügelte Waffen. Sam ist von vornherein schwierig, weil stark verhaltensauffällig. Zu allem Überfluss wird er in der Schule mit einer seiner Waffen erwischt. Amelia muss ihn aus der Schule nehmen.
Sam wird immer schwieriger, was auch mehr Druck für die Mutter bedeutet. Als Amelia Sam abends Geschichten vorliest, löst das makabre Kinderbuch „The Babadook“ bei ihr einen psychotischen Schub aus. Amelia leidet an Angstzuständen, wird zunehmend depressiv und zieht sich immer mehr zurück. Sie hat Halluzinationen, die sie so weit treiben, dass sie ihren Sohn töten will. Mit seinen selbstgebastelten Waffen, setzt Sam seine Mutter immer wieder kurzfristig außer Gefecht. Letztlich bekommt Amelia ihn zu fassen und versucht ihn zu erwürgen. Sam streichelt währenddessen sanft ihre Wangen und beteuert, dass er sie immer beschützen wird. Amelia findet durch diese bedingungslose Liebe ihres Kindes wieder in die reale Welt zurück.
Der kleine Sam wusste also genau, auf welches Monster er sich die ganze Zeit über vorbereitet hat. Amelia kann ihre Monster (sprich, Ängste) nun wieder weit in die Untiefen ihres Unterbewusstseins zurückdrängen. Vielleicht nur bis zu Sams achtem Geburtstag, dem nächsten Todestag ihres geliebten Mannes.
Auch ohne das Monster Babadook ist diese Geschichte ein ziemlich packender Stoff. Allerdings sind das Drehbuch und die Regie von Jennifer Kent viel cleverer als das Marketing des Films. Der Trailer suggeriert einen Monsterfilm und auch auf der Facebook-Seite sehe ich fast nur Bilder des Monsters. Natürlich weckt das beim Publikum gewisse Erwartungen. Auch wenn eigentlich eine viel bessere Geschichte erzählt wird, als nach dem Trailer zu erwarten war, sind Horror-Fans enttäuscht. Das müsste nicht sein. Immerhin haben es andere Geschichten mit ähnlichen Themen zum Klassiker gebracht.
Anleihen bei Stephen King?
Rückzug, Einsamkeit, Wahnsinn und Gewalt gegen die Familie: Hört sich an, als gäbe es da einige Gemeinsamkeiten mit dem Stephen King-Klassiker „The Shining“. Mit dem Unterschied, dass hier doch übernatürliche Kräfte am Werk sind: Das Overlook Hotel in „The Shining“ hat eine eigene böse Persönlichkeit und nimmt Besitz von Jack Torrance [im Film gespielt von Jack Nicholson]. Außerdem ist Jacks Sohn übersinnlich begabt; er kann Ereignisse aus der Zukunft und der Vergangenheit ebenso sehen wie Geister. Doch anders als Jack Torrance in „The Shining“ ist Amelia in „The Babadook“ nichts Übernatürlichem ausgesetzt, das von ihr Besitz ergreift. Das Kinderbuch ist nur der Auslöser dafür, dass Amelia völlig in eine Wahnwelt abdriftet.
Parallelen zu einem Gothic Horror-Klassiker
„The Babadook“ hat mich vielmehr an eine ganz andere Geschichte erinnert. „The Innocents“ (mit dem schrecklich blöden und unpassenden deutschen Titel „Das Schloss des Schreckens“). Der Film aus 1961 basiert auf der Gothic Horror-Novelle „The Turn of the Screw“ des amerikanisch-britischen Autors Henry James aus dem Jahr 1898. Es ist eine Geistergeschichte, doch lässt sie verschiedene Deutungen zu. Für die Verfilmung verfasste ein anderer großer Autor das Drehbuch: Truman Capote. Dieser entschied sich für eine eindeutigere Version, als die Vorlage es ist.
Inhalt – The Innocents
Miss Giddens [Deborah Kerr] kommt auf einen riesigen Landsitz als neue Gouvernante der Kinder Flora und Miles. Deren frühere sehr enge Bezugspersonen waren das Kindermädchen Miss Jessop, die sich im Jahr davor ertränkte, und ihr Liebhaber – der attraktive, aber brutale Peter Quinn. Auch er ist tot. Immer wieder sieht Miss Giddens die Geist-Erscheinungen einer Frau und eines Mannes, Jessop und Quinn. Und bald wird ihr klar: Die Kinder sind von den Geistern der beiden Verstorbenen besessen. Sie tuscheln und lachen unverschämt und hinter der unschuldigen Fassade stecken böse Gedanken und Taten. Miss Giddens konfrontiert Flora mit der Wahrheit, doch diese wehrt sich und beginnt ihre Gouvernante übel zu beschimpfen. Danach sorgt Miss Giddens dafür, dass sie mit Miles die Nacht ganz alleine im Haus verbringt. Sie will Miles mit dem Geist von Peter Quinn konfrontieren. Miles soll seine Besessenheit von Quinn zugeben. Es gelingt: Peter Quinn erscheint. Die Gouvernante hält währenddessen den schreienden, weinenden Jungen fest umklammert. Als Quinn verschwindet, ist der Junge tot. Weinend drückt ihm die Gouvernante einen langen Kuss auf den Mund.
Nur eine altmodische Geistergeschichte?
Als ich den Film als Teenager sah, habe ich ihn als reine, reichlich altmodische Geistergeschichte mit einigen recht gruseligen Szenen erlebt. Vor kurzem habe ich ihn zufällig wieder gesehen, aber mit ganz anderen Augen. Plötzlich wurde mir klar: Die Geist-Erscheinungen sind die Fiktion einer nicht mehr ganz jungen Gouvernante mit paranoider Psychose und unterdrückten sexuellen Fantasien.
Als „The Innocents“ 1961 herauskam, waren die Kritiker voller Lob, doch das Publikum war weniger begeistert. Es war also so ähnlich wie heute bei „The Babadook“. Möglicherweise braucht es ja immer einige Jahre, bis die Leute lernen, einen Film richtig zu schätzen – oder losgelöst von den Erwartungen anzusehen, die der Trailer erzeugt. Das junge Publikum von heute, das Jump Scares und Blood and Gore erwartet, könnte sich schon in ein paar Jahren für die dahinterliegende Geschichte interessieren. Ich hoffe es zumindest.
Filme über psychische Störungen sind freilich nicht automatisch gute Horrorfilme. Sie sind auch nur eine Variante des psychologischen Horrors. Vielleicht sind jetzt aber einige von denen, die Horrorfilme meiden, doch neugierig geworden. Wenn ja: Guten Grusel beim Anschauen.
Übrigens: Für „The Babadook“ ist leider noch kein Filmstart Österreich oder Deutschland festgelegt.