Ein Überblick von Wolfgang M. Bauer

Wolfgang M. Bauer
Die Informationsfreiheit oder „Freedom of Information (FOI)“ ist in mindestens 95 Staaten dieser Erde (Stand 2013)[1] ein zumindest theoretisch gesetzlich geregeltes BürgerInnenrecht. Theoretisch deshalb, weil darunter auch Staaten wie China sind. Aber auch in Österreich ist das bereits in den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts beschlossene Bundesgesetz über die Auskunftspflicht ein eher theoretisches Konstrukt. Es konkurriert nämlich mit dem im Verfassungsrang befindlichen Amtsgeheimnis, einem Relikt aus 1920. Beinahe 100 Jahre später könnte nun endlich Realität werden, was zum Beispiel in Schweden schon anno 1766[2] beschlossen wurde und bis heute Gültigkeit[3] hat.
Worum geht es nun eigentlich bei dieser Informationsfreiheit und was bringt diese?
Das Recht auf Informationsfreiheit findet ihren Niederschlag z.B. im Hamburger Transparenzgesetz[4], das aktuell als eines der fortschrittlichsten gilt. Einige hervorstechende Punkte daraus: es gilt nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen und dabei der Kontrolle der öffentlichen Hand unterliegen. Des Weiteren ist ein wichtiger Punkt, dass viele Informationen von einer Hol- zu einer Bringschuld werden und es in der Verantwortung der Organisationen liegt, die BürgerInnen zu informieren. Auch werden die anfallenden Kosten und das Verhältnis zum Datenschutz klar geregelt. Zusammengefasst kann man sagen, dass Transparenz und damit einhergehende öffentliche Kontrolle Korruption, Freunderl- und Mißwirtschaft verhindern können: gläserner Staat statt gläserne Bürgerinnen und Bürger!
Dabei gilt es die verschiedenen Aspekte zu betrachten und die Interessen diverser Akteure gegeneinander abzuwägen. Diese Sichtweisen und Interessen machen die Informationsfreiheit zu einem derart kontroversen, wenngleich größtenteils abseits der Öffentlichkeit diskutierten Thema. Was schon einmal grundsätzlich falsch ist.
Amtsgeheimnis
Geradezu dogmatisch klammern sich manche Ämter in Österreich an „ihr“ Amtsgeheimnis, eine politische Perversion des frühen 20. Jahrhunderts, welche es in der EU ausschliesslich in Österreich nach wie vor im Verfassungsrang gibt. Ein Relikt aus der Zeit, als die selbsternannten Eliten frei nach dem Motto „Wissen ist Macht“ den Zugang zu Information für das gemeine Volk nach Möglichkeit total verhindern wollten. Heute wird oft versucht, das Amtsgeheimnis mit dem Deckmantel des Datenschutzes zu rechtfertigen, dabei ist das bloß ein Feigenblatt, welches das Nichtvorhandensein echter Argumente bedecken soll.
 Informationsfreiheit steht nämlich nicht grundsätzlich in Konkurrenz zum Datenschutz. Schützenswerte persönliche Daten können ja jederzeit ausgenommen bzw. geschwärzt werden. Es bleibt natürlich grundsätzlich die Frage, was schützenswerte Daten sind! Es gibt klare Fälle und solche wo es weniger klar ist. Außerdem liegt die Schmerzgrenze bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist das Gefühl von Privatsphäre aber oft ein sozialisiertes und hängt stark davon ab, in welcher Gesellschaft man aufwächst. In den USA ist es kein Problem, offen über das Einkommen zu sprechen, in Schweden sind praktisch alle Daten öffentlich. Hunderte Millionen Menschen leben sehr gut damit, dass alle wissen, wie viel man für die erbrachte Leistung vergütet bekommt. Was für Personen gilt, muss für Organisationen schon lange gelten. Überhaupt gilt es zu überdenken, ob Organisationen Personenrechte im herkömlichen Sinn genießen sollen.
Informationsfreiheit steht nämlich nicht grundsätzlich in Konkurrenz zum Datenschutz. Schützenswerte persönliche Daten können ja jederzeit ausgenommen bzw. geschwärzt werden. Es bleibt natürlich grundsätzlich die Frage, was schützenswerte Daten sind! Es gibt klare Fälle und solche wo es weniger klar ist. Außerdem liegt die Schmerzgrenze bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist das Gefühl von Privatsphäre aber oft ein sozialisiertes und hängt stark davon ab, in welcher Gesellschaft man aufwächst. In den USA ist es kein Problem, offen über das Einkommen zu sprechen, in Schweden sind praktisch alle Daten öffentlich. Hunderte Millionen Menschen leben sehr gut damit, dass alle wissen, wie viel man für die erbrachte Leistung vergütet bekommt. Was für Personen gilt, muss für Organisationen schon lange gelten. Überhaupt gilt es zu überdenken, ob Organisationen Personenrechte im herkömlichen Sinn genießen sollen.
Ganz wichtig ist, dass es ein echtes Recht zur Akteneinsicht gibt und keine Informations- oder Auskunftspflicht des Amtes. Solche Auskunftspflichten bzw. Verpflichtungen zum Veröffentlichen von Informationen kann es zusätzlich geben, aber grundsätzlich müssen Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, uneingeschränkt und direkt in die Akten Einsicht zu nehmen.
Der aktuelle Entwurf des Bundeskanzleramtes ist leider das Papier nicht wert auf dem es geschrieben steht, zumindest wenn man ein Transparenzgesetz möchte, das seinen Namen wert ist![5]
Die vier wichtigsten Kritikpunkte sind laut transparenzgesetz.at[6]:
* Ausnahmen taxativ aufzuzählen und keine vagen Ausnahmeregelungen zu ermöglichen, die in letzter Konsequenz bloße Gummiparagraphen erzeugen.
* Es muss eine verbindliche Lösung für alle Ebenen geben. Informationsfreiheit ist ein allgemeines BürgerInnenrecht, welches immer und überall besteht, egal ob auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene.
* Die Mäßigkeit muss gewährleistet werden: wegen eines schützenswerten Namens darf nicht das gesamte Dokument zurückgehalten werden.
* Eine Instanz, die den Antragstellern zur Seite steht und diesen auch ohne langwierige und teure Gerichtsverfahren zu ihrem Recht verhilft.
Wir sehen, dass es bereits positive Entwicklungen und begrüßenswerte Ausnahmen gibt, aber es muss ein Recht der Bürgerinnen und Bürger werden und eine Pflicht des Staates und staatsnaher Organisationen. Österreich ist international leider Schlusslicht was die Informationsfreiheit angeht[7]. Die Kritik des renommierten Ludwig Boltzmann Institutes für Menschenrechte (BIM) für den aktuellen Vorstoss der Regierungsparteien fällt entsprechend katastrophal aus[8].
Wir haben ein Recht auf Information und die Politik muss das akzeptieren und umsetzen!
Abschließend möchte ich in diesem Zusammenhang noch die positiven Entwicklungen im Rahmen von Public Sector Information (PSI)[9] und Open Government Data (OGD)[10] erwähnen. Mehr zum Thema findet man zum Beispiel hier (http://futurezone.at/netzpolitik/ngo-fuer-informationsfreiheit-in-oesterreich-gegruendet/27.596.928) oder unter den anderen im Text genannten Links.
[1] http://right2info.org/access-to-information-laws
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheit#Schweden
[3] http://www.verfassungen.eu/sw/index.htm
[4] http://www.hamburg.de/transparenzgesetz/
[5] http://derstandard.at/1395363154968/Neues-Transparenzgesetz-Viele-Hintertueren-eingebaut
[6] http://www.informationsfreiheit.at/
[7] http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1260095/Osterreich-ist-Schlusslicht-bei-Informationsfreiheit
[8] http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_00987/imfname_349411.pdf
[9] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/implementation-psi-directive-austria
[10] http://open.semantic-web.at/display/OGDW/4.4+Zwischen+PSI+Informationsfreiheitsgesetzen+und+Auskunftspflicht
 Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir fällt es immer schwerer Nachrichten zu sehen und zu lesen. Mir scheint, dass monatlich eine neue Weltregion dazu kommt, die im Krieg versinkt. Die Bilder gleichen sich immer mehr. Junge Männer mit Waffen in der Hand. Explosionen und zerstörte Gebäude. Frauen und besonders Kinder mit vor Angst geweiteten Augen oder mit einem abgestumpften toten Blick. Menschen auf der Flucht oder Tote, die auf den Straßen liegen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Im Irak töten Muslime Muslime, Christen und Jesiden. In Israel und Gaza vernichten sich Juden, Muslime und Christen. In der Ukraine passiert der Wahnsinn zwischen prorussischen und ukrainischen Christen. In Syrien, in Nigeria, in Afghanistan, in Pakistan, in Somalia, im Kongo und so weiter und so fort – Menschen töten Menschen, so berichten es die Medien tagtäglich.
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir fällt es immer schwerer Nachrichten zu sehen und zu lesen. Mir scheint, dass monatlich eine neue Weltregion dazu kommt, die im Krieg versinkt. Die Bilder gleichen sich immer mehr. Junge Männer mit Waffen in der Hand. Explosionen und zerstörte Gebäude. Frauen und besonders Kinder mit vor Angst geweiteten Augen oder mit einem abgestumpften toten Blick. Menschen auf der Flucht oder Tote, die auf den Straßen liegen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Im Irak töten Muslime Muslime, Christen und Jesiden. In Israel und Gaza vernichten sich Juden, Muslime und Christen. In der Ukraine passiert der Wahnsinn zwischen prorussischen und ukrainischen Christen. In Syrien, in Nigeria, in Afghanistan, in Pakistan, in Somalia, im Kongo und so weiter und so fort – Menschen töten Menschen, so berichten es die Medien tagtäglich.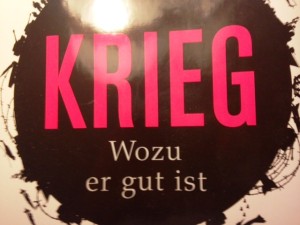 Ian Morris meint in seinem Buch „Krieg- Wozu er gut ist“, dass Krieg zu Fortschritten führt, zu mehr Menschenrechten, zu Demokratie. Dem kann ich nicht zustimmen. Wie soll Gewalt zu Gewaltfreiheit führen? Viele Kriege und Konflikte entstehen ja nicht aus dem Frieden heraus sondern aus Situationen, in denen Menschen unter Gewalt und Unterdrückung leiden. Oder wenige wollen Macht haben über viele und über Ressourcen. Nicht eine religiöse Überzeugung oder eine politische Haltung machen aus Menschen Mörder, das ist nur eine schnelle oberflächliche Erklärung, um Menschen dazu zu bringen über andere herzufallen. Die, die den Krieg antreiben wollen Macht, die sie sich mit Gewalt holen.
Ian Morris meint in seinem Buch „Krieg- Wozu er gut ist“, dass Krieg zu Fortschritten führt, zu mehr Menschenrechten, zu Demokratie. Dem kann ich nicht zustimmen. Wie soll Gewalt zu Gewaltfreiheit führen? Viele Kriege und Konflikte entstehen ja nicht aus dem Frieden heraus sondern aus Situationen, in denen Menschen unter Gewalt und Unterdrückung leiden. Oder wenige wollen Macht haben über viele und über Ressourcen. Nicht eine religiöse Überzeugung oder eine politische Haltung machen aus Menschen Mörder, das ist nur eine schnelle oberflächliche Erklärung, um Menschen dazu zu bringen über andere herzufallen. Die, die den Krieg antreiben wollen Macht, die sie sich mit Gewalt holen.





![P1030172[1]](http://zartbitter.co.at/wp-content/uploads/2014/07/P10301721-300x225.jpeg)







