Vier Flüchtlinge aus vier Ländern werden an der Universität Salzburg im Rahmen des Projekts „refugee stories – Geschichten einer Flucht“ über ihr gefährliches Leben berichten. Darunter auch Gerald Manjuo, der von Kamerun nach Salzburg kam und den wir nun näher vorstellen.
Früher war Gerald Manjuo als Reiseführer auf der gesamten Welt unterwegs. Er arbeitete unter anderem einige Jahre für die Swiss Air, darum spricht der Kameruner auch sehr gut Deutsch. Im Juni dieses Jahres kam er nach Traiskirchen, seit Juli wohnt er in Salzburg. Er musste flüchten, weil er in seinem Heimatland Kamerun politisch verfolgt wurde.
Der afrikanische Staat war bis zum Ende des 1. Weltkriegs eine deutsche Kolonie. Danach wurde er zwischen den Briten und Franzosen aufgeteilt. Seit 1960 ist Kamerun eine Präsidialrepublik mit einer eigenen Verfassung, dennoch besteht noch immer eine große soziale Kluft zwischen den beiden Territorien. Gerald Manjuo kommt aus dem ehemals britisch besetzten Teil Kameruns, genauer gesagt aus der Zwei-Millionen-Metropole Douala, das im Südwesten an den Atlantik grenzt.
„Kamerun ist geprägt von Korruption, und es gibt ständig Menschenrechtsverletzungen. Der Westen des Landes steuert vor allem durch die Öl-Vorkommen einen Großteil für das wirtschaftliche Vorankommen bei, dennoch werden wir noch immer unterdrückt“, erklärt der 43-Jährige.
Also habe er sich mit anderen Gleichgesinnten zusammengeschlossen, um gegen diese Ungerechtigkeiten vorzugehen. Bei einem Treffen der 53 Staaten des Commonwealth hatte er die Möglichkeit, seine Anliegen den ausländischen Politikern zu schildern. „Ich war danach drei Wochen im Gefängnis, konnte mit niemandem sprechen.“ Sie hatten ihm während dieser Zeit auch gedroht, dass er bei einem weiteren Verstoß die Todesstrafe bekommen würde.
Dennoch ließen sich Gerald Manjuo und seine Mitstreiter nicht mundtot machen. „Wir haben eine Gruppe gegründet und versucht, vor allem über die Medien auf die Missstände aufmerksam zu machen.“ Nach einem Bombenanschlag auf ein Studentenheim wurde seine Gruppe als Drahtzieher des Attentats beschuldigt, obwohl es keinerlei Beweise gab. „Das war für die Regierung eine gute Chance, uns loszuwerden.“ Manjuo musste sich daraufhin verstecken, durch gute Kontakte gelang ihm schließlich per Flugzeug die Flucht. Zuerst in die Türkei und dann nach Österreich.
Nun versucht er, den Dialog mit Politikern in ganz Europa zu suchen. „Europa hat an unserer Misere großen Anteil und muss uns endlich helfen“, sagt er. Er hofft, dass der jetzige Präsident in Kamerun, Paul Biya, der bereits seit 1982 im Amt ist, bald Geschichte sein wird. „Er ist 82 Jahre alt. Ich sehne mich nach einem Ende seiner Herrschaft“, sagt Gerald Manjuo, der hofft, in ein paar Jahren zu seiner Familie nach Kamerun zurückkehren zu können.
Informationen zum Projekt: „refugee stories – Geschichten einer Flucht“ wurde vom Friedensbüro und dem Verein Intersol ins Leben gerufen. Vier Flüchtlinge erzählen in der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät über ihr Leben auf der Flucht. Die Termine der moderierten Gespräche sind am 28. Oktober, 11. November, 25. November und 9. Dezember ab jeweils 17.30 Uhr im Hörsaal 381.



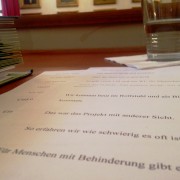





![12025556_10204492936795197_177902676_n[1]](http://zartbitter.co.at/wp-content/uploads/2015/09/12025556_10204492936795197_177902676_n1-300x225.jpg)
![12022971_10204492937155206_1437836258_n[1]](http://zartbitter.co.at/wp-content/uploads/2015/09/12022971_10204492937155206_1437836258_n1-300x168.jpg)


![CAM00173[1]](http://zartbitter.co.at/wp-content/uploads/2015/06/CAM001731-300x225.jpg)