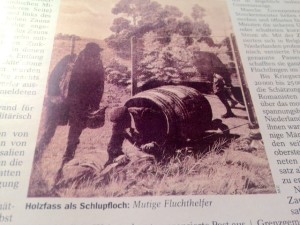Alle reden jetzt über Köln. Und das ist gut so. Busengrapschen und Potatschen und mehr. Das war vor 25 Jahren als ich im Gastgewerbe gearbeitet habe für viele Frauen Normalität. Ich hatte damals schon einen Chef, der jeden Gast, der übergriffig wurde, vor die Tür gesetzt hat. Keine Selbstverständlichkeit damals. Das wurde oft als Lappalie abgetan. Es war ein langer Weg auch für die Frauenbewegung das klarzustellen. Hieß es doch oft, dass es einfach ein Emanzen- und FeministInnengejammere sei. Und ich erinnere mich noch gut vor etwa 15 Jahren. Da gab es in unserem Jugendzentrum ein großes Problem. Daneben war ein Beisl. Und die Stammgäste, die schon am Vormittag ins Bierglas geschaut haben, haben unsere Mädchen angemacht, ihnen Geld angeboten, wenn sie mal kurz mitkämen. Das haben die natürlich entrüstet abgelehnt und die Betreuer informiert. Die haben wiederum mit den Gästen geredet. Was denkt ihr haben die gesagt? „Die sollen sich nicht so haben. Wenn sie schon die Nägel lackieren und einen Minirock tragen, dann müssten sie damit rechnen.“
Ekelhaft.
Aber bis heute oft noch ein Argument, wenn eine Frau sich über sexuelle Belästigung beschwert. Und jetzt Köln. Offensichtlich gingen die kriminellen Handlungen von Männern mit Migrationshintergrund aus. Und alle sind sich einig, das geht gar nicht! Genau, das geht gar nicht! Und wenn Köln wieder aus der medialen Aufmerksamkeit draußen ist möchte nie wieder etwas davon hören, dass sexuelle Belästigung ein Emanzengejammere ist. Wenn so etwas vorfällt, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder beim Nachbarn und der Täter ein Mann mit oder ohne Migrationshintergrund ist. Dann soll das einhellig verurteilt werden von allen, so wie jetzt. Das wünsche ich mir!