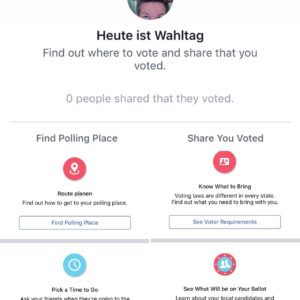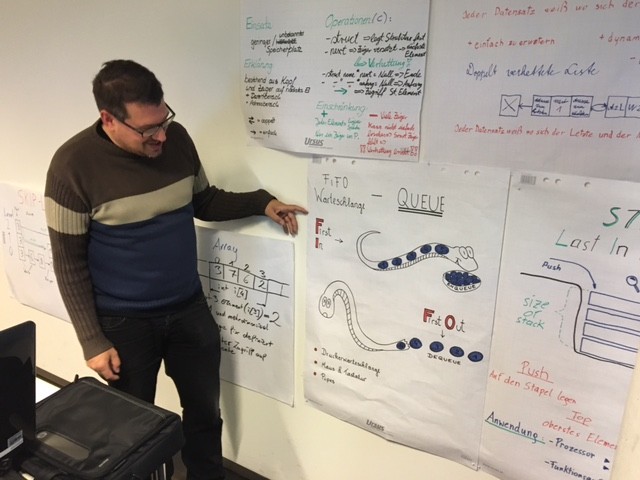Wählen in Österreich ist eine einfache Sache. Zettel her, kreuz machen, einwerfen. Trotzdem sind unsere Wahlbeteiligungen nicht berauschend.
Vor ein paar Jahren hatten wir in der Stadt Salzburg gleichzeitig Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen – da wurde es für manche Menschen schon kompliziert. Als Wahlbeisitzer habe ich einige Male folgende Frage gehört: „Warum geben Sie mir so viele Zettel? Ich will doch nur wählen gehen.“
In den USA liegt die Wahlbeteiligung etwa bei etwas über 55 Prozent – noch niedriger als bei uns. Aus den Medien war in letzter Zeit wieder zu erfahren, warum das so ist und wie es manchen Wählergruppen absichtlich schwer gemacht wird, sich zur Wahl zu registrieren.
Aber es gibt da noch einen anderen Grund – zumindest glaube ich, dass es noch einen Grund gibt: Abgesehen davon, dass über die Präsidentschaft, Kongress und andere Ämter abgestimmt wird, entscheiden die Menschen hier auch über eine Vielzahl von Gesetzesvorlagen.

223 Seiten voller Juristenenglisch – alleine der „Kurzüberblick“ ist 10 Seiten. Wer liest sich das alles durch? Und wer versteht das dann wirklich?
Jeder Haushalt erhält verschiedenste kleinere Büchlein mit gut gestalteten, leicht verständlichen Informationen übers Wählengehen. Zusätzlich kommt aber auch ein dicker Katalog, der die gesamten Texte der Gesetzesvorlagen enthält, über welche die Menschen entscheiden sollen – samt Änderungen und Streichungen. Dazu gibt es auch ausführliche Beschreibungen der Pro- und Kontra-Argumente. 223 Seiten voller Juristensprache umfasst dieser Katalog in Kalifornien.
So indirekt der Präsident bzw. hoffentlich die Präsidentin hier gewählt wird (letztlich wählen ja die Wahlmänner jedes Staats den Präsidenten), so viel direkte Demokratie gibt es. Und die wird ja sehr oft bei uns verlangt.
Darum stelle ich mir die Frage: Wie viele Leute würden sich bei uns an dieser Art der direkten Demokratie beteiligen? Und ist das überhaupt sinnvoll? Immerhin geht dabei oft es um hochkomplexe Fragen. Oder sollten wir nur mit werbeplakatgerechten Sprüchen zu einer Entscheidung bewogen werden? Diesen Eindruck habe ich oft. Denn mehr direkte Demokratie wird bei uns in Österreich meist dann verlangt, wenn Populisten ein passendes Thema gefunden haben, mit denen sich Emotionen schüren lassen.
Und noch was
Facebook schickt heute allen eine Erinnerung, dass Wahltag ist. Man kann per Button das zuständige Wahllokal finden, die Route dorthin ansehen, sich anmelden und auf Facebook bekannt geben, dass man schon gewählt hat – so sollen auch andere motiviert werden auch tatsächlich hinzugehen. Nicht schlecht, oder? Was haltet ihr davon?