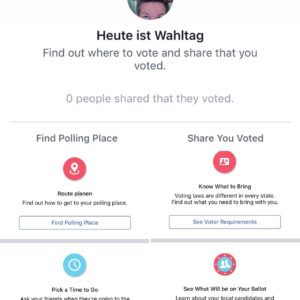Fürs Kekse essen braucht es eigentlich keine Argumente. Man stellt einen Teller voller Kekse auf den Tisch, das ist Argument genug. Aber es gibt durchaus Argumente fürs Nichtbacken und die sind immer die gleichen: keine Zeit, viel zu kompliziert, kann ich eh kaufen.
Ich möchte fünf Gründe bringen, warum es gut tut, selbst Kekse zu backen:

1. Sich aufs Kekse backen vorzubereiten macht schon viel Freude. Backbücher durchblättern, im Internet nachschauen, Einkaufslisten schreiben. Und sich die spannende Frage stellen, mit welchem Keks starte ich dieses Jahr?
2. Spätestens wenn der erste Keksduft durch die Küche weht, ist man verloren. Aus den geplanten fünf Sorten werden dann schnell mal zehn oder mehr.
3. Kekse verzeihen sehr viel. Wenn man die Grundregeln einhält, etwa beim Mürbteig kneten nur kalte Butter verwenden, dann kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es lässt sich jedes Rezept variieren. Die einen mögen es nussig, die anderen fruchtiger, ich mag es schokoladig.
4. Wenn man dann mitten drin ist im Backwahn, dann ist es fast wie meditieren. Es ist egal wie spät es ist, Hunger verspürt man nicht und eine Sorte geht dann immer noch.
5. Und wenn man dann beginnt die ersten Kekse zu verschenken, bewahrheitet sich der alte Bibelspruch „Geben ist seliger denn nehmen.“ Mit selbstgebackenen Keksen macht man Menschen glücklich.
Viel Freude euch allen in der Keksbacksaison 2016!

PS: Und statt bei diversen Weihnachtsfeiern über die Arbeit oder übers Wetter zu sprechen sollte man es mal einem Erfahrungsaustausch übers Keksebacken probieren.
Und hier ein paar Keksrezepte: