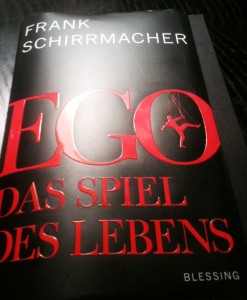Nichts ist so spannend, wie darauf zu warten, dass in einem Godzilla-Film das erste Mal das Wort „Godzilla“ ausgesprochen wird – und zwar auf Japanisch: Gojirah [ɡoꜜdʑiɽa]. Es klingt nach ehrfürchtigem Erschauern.
Ein Monster mit Geschichte
1954 terrorisierte die urzeitliche Riesenechse erstmals Tokio. Der Film bildete das Trauma der von Atombombenabwürfe und Reaktorunfällen heimgesuchten Japaner ab. Es folgte eine ganze Serie trashiger Filme, in denen Godzilla gegen andere monströse Gegner kämpft: King Kong, Mechagodzilla, Gidorah, usw. Diese B-Movies fanden eine eingefleischte Fangemeinde. Roland Emmerich wagte sich 1998 an ein großes Remake – und den ersten amerikanischen Godzilla-Film. Groß war jedenfalls das Budget, der Film selbst war … von Roland Emmerich halt.
Überraschend und düster
Jetzt, 16 Jahre später, gibt es eine Neuauflage – wieder aus Amerika von Regisseur Gareth Edwards. Und ehrlich gesagt, ich muss mir noch Gedanken darüber machen, wie mir der Film letztlich gefallen hat. Ganz schlüssig bin ich mir nämlich noch nicht. Dabei hat dieser neue Godzilla wirklich viel zu bieten. Zum einen und am überraschendsten für mich: mehr als nur ein Monster. Es sind sogar drei. Ich dachte, das gibts nur in den Godzilla-Trash-Filmen. Dann bietet der Film auch noch wunderbar düstere Bilder. Über dem halb zerstörten San Francisco hängen dicke Schwaden aus Staub und Rauch. Diese geben oft nur Teile der Monster preis und lassen sie auch immer wieder wie aus dem Nichts auftauchen. Richtig beklemmend die Szene, als Soldaten über der dick mit gelben und grauen Rauch- und Staubwolken verhangenen Stadt aus dem Flugzeug abspringen – sozusagen ins völlig Unbekannte. Sie wissen nicht, was sie dort unten erwartet. Und zuletzt das, was nicht fehlen darf: Ein japanischer Wissenschaftler gibt dem Grauen einen Namen: „Gojira!“
Ehrfürchtiges Erschauern.

Der Film bezieht sich auch auf den Ur-Godzilla. Ganz interessant gemacht in richtigem Doku-Stil, mit Filmmaterial von Atombomben-Tests der 50er und 60er Jahre. Im Film wird übrigens erklärt, dass das gar keine Tests waren, sondern Versuche, Godzilla zu töten. Außerdem sieht der neue Godzilla nicht so sehr anders aus als die aufrecht stapfende Riesenechse aus dem allerersten Film von 1954, in der ein Mensch im Gummikostüm steckte. Ein bisschen plump und behäbig, nicht wie der wendige T-Rex, den uns Roland Emerich in seinem Film als Godzilla auftischte.
Menschen wie Ameisen
Eine stringente Geschichte über Menschen zu erzählen, ist allerdings keine Stärke des Films. Im Prolog verbindet der Film eine Katastrophe ganz gut, wenngleich etwas klischeehaft, mit menschlicher Tragödie (Joe Brody [Bryan Cranston], der Vater des späteren Haupthelden, verliert bei einem Reaktorunfall seine Frau [Juliette Binoche]). Den Rest der Laufzeit über gelingt ihm das nicht einmal mehr in Ansätzen. So viel Staunen die visuell beeindruckenden Szenen bewirken, so sehr wirken sie ungelenk aneinandergereiht. Das macht auch den Protagonisten des Films Ford Brody [Aaron Taylor-Johnson] kaum erwähnenswert. Ich kann nicht behaupten, dass ich mit Aufregung sein persönliches Schicksal verfolgt hätte. Der Soldat Ford Brody schlägt sich zwar den ganzen Film über durch, aber er war weder tapferer, mutiger oder klüger als die anderen. Um ihn herum sterben reihenweise die Menschen; sie werden zertrampelt, stürzen zu Tode etc. – wie Ameisen. Und es wird ganz klar: Die Menschen sind nur unbedeutende Kleinkreaturen, von denen die Monster nicht mal richtig Notiz nehmen. Außer in einer einzigen Szene am Schluss. Das war leider etwas inkonsequent, gehört aber wahrscheinlich als Spannungselement einfach dazu.
Zu Höherem bestimmt
Godzilla erhält eine ganz interessante Rolle. Die Menschen bewarfen ihn 1954 mit Atombomben (für ein Millionen Jahre altes Wesen war das praktisch erst gestern). Das Monstrum trägt uns das aber nicht nach und rächt sich nicht. Seine Aufgabe ist es nämlich, so die Erkenntnis des japanischen Wissenschaftlers (Godjirah!), ein Gleichgewicht auf der Erde zu erhalten. – Gott? – Die Menschen sind ihm jedenfalls gleichgültig. Vielleicht rechtfertigt das die seltsame Distanz, die der Film seinen eigenen Protagonisten gegenüber hält.
Meine Bewertung auf IMDB: 7 Sterne
Großartige Bilder (natürlich in 3D) und die düstere Stimmung machen den Film schon sehenswert, das wäre mir 9 Punkte wert. Auf der menschlichen Ebene hält sich die Sogwirkung des Films allerdings in Grenzen. Das trübt das Filmerlebnis.
Hier der Langtrailer http://www.youtube.com/watch?v=Y9NAdVHXme8