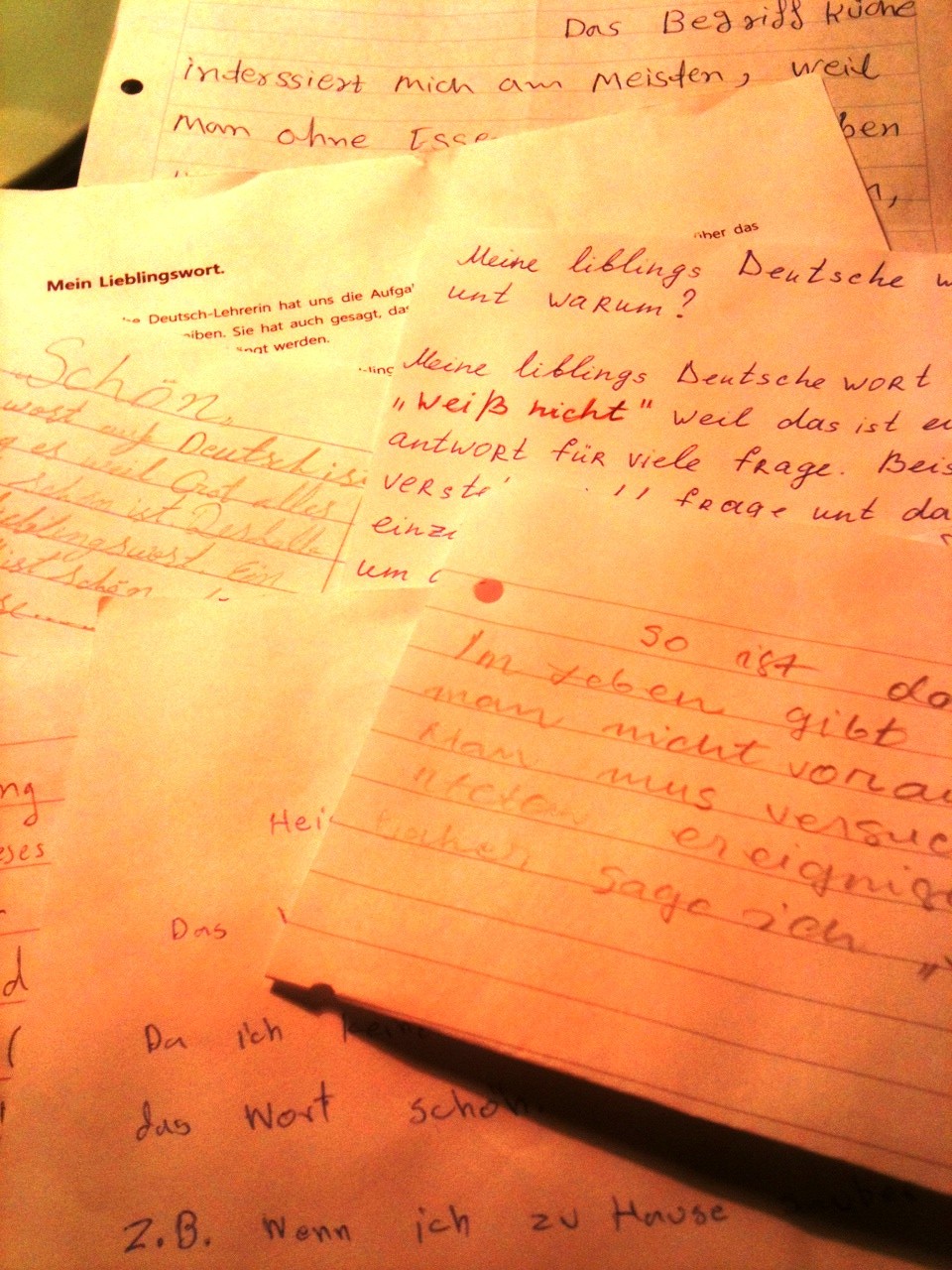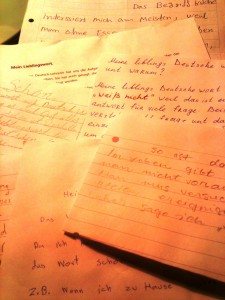Gerade hatte ich wieder eine Erbschaftssteuerdiskussion mit Menschen aus der so oft zitierten „Mittelschicht“ von der eigentlich keiner weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört. (*edit 21.02.13: die im Folgenden aufgestellten Thesen sind grds. 1:1 auch auf Vermögens- und Schenkungssteuer anwendbar)
Wenn man es am Einkommen festmacht, reicht das Spektrum von (Hausnummer netto) 1.500 bis 10.000 Euro / Monat. Je nachdem, wen man frägt.
Wenn man es am Vermögen festmacht – was keiner tut – ist es schon viel schwieriger, abgesehen von der Erhebung der Vermögen. Vereinfacht gefragt: Gehört man mit 50.000 am Sparbuch schon, bzw. mit 500.000 nicht mehr zur Mittelschicht? Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Vor allem im Zusammenhang mit Sachwerten sowie Grund & Boden.
Fest steht jedoch, dass die „Mittelschicht“ vermutlich die größte Gesellschaftsgruppierung in Österreich ist, und sehr viele von ihnen die Erbschaftssteuer aus zwei Gründen ablehnen: 1) weil „sie“ glauben, dass es sie selbst trifft und 2) weil es sich um bereits versteuertes Einkommen handle.
 Bevor ich nun auf diese zwei „Irrtümer“ eingehe, möchte ich kurz folgende, immer wieder diskutierte, Punkte in den Raum stellen:
Bevor ich nun auf diese zwei „Irrtümer“ eingehe, möchte ich kurz folgende, immer wieder diskutierte, Punkte in den Raum stellen:
- Die Mittelschicht läuft der Illusion nach, dass sie aufgrund von relativem (guten) Wohlstand selbst zu den „Reichen“ gehört. Das stimmt jedoch nicht!
- Die Mittelschicht versteht daher auch nicht, dass eine fehlende Erbschaftssteuer fehlende Einnahmen für den Staat bedeuten, und somit die Lohn- und Einkommenssteuer nicht gesenkt werden kann.
- Es stöhnt zwar jeder unter dem hohen Steueranteil, (fast) niemand kommt jedoch auf die Idee, dass dieser überhaupt erst ermöglicht, dass eben die wirklichen Superreichen keine Erbschaftssteuer zu zahlen haben, wenn sie ihr Vermögen vererben.
- Man könnte also sagen, die Mittelschicht bezahlt die Steuerfreiheit der Superreichen und wird mit dem Akzeptieren und Verteidigen der aktuellen Gesetzeslage zu den Steigbügelhaltern der Superreichen.
- Eine fehlende Erbschaftssteuer ist nichts anderes als die „Reinkarnation“ des Feudalismus. Vermögen und somit Macht oder auch Grundbesitz wird (steuerfrei) weitergegeben. Nichts anderes passierte in den Feudalsystemen Europas.
- Hohe Vermögen führen zu hohem leistungsfreien (sic!) Einkommen!
- Eine Erbschaftssteuer trifft – bei Freigrenzen – nicht unbedingt versteuertes Vermögen, da mit steigendem Einkommen und Vermögen die Möglichkeiten der „Steuerschonung“ exorbitant steigen. (Stichwort Stiftungen und Steueroasen)
Zu Punkt 1)
Ich selbst bin der Meinung, dass es bei einer allfälligen Erbschaftssteuer Freigrenzen geben muss. Vermögen sollte erst ab einer bestimmten Höhe besteuert werden. Dann trifft es auch nicht den vielzitierten Haus- oder Wohnungserben. Wenn eine solche – zu diskutierende – Höhe bei z.B.: 1 Mio Euro in liquiden Mitteln liegt, fallen 99 %, die sich selbst zur „Mittelschicht zählen“, automatisch raus. (Sachwerte müssen seperat betrachtet werden)
Dass dann niemand mehr überbleibt, der noch eine Erbschaftssteuer zahlen müsste halte ich für eine Mähr. Das belegen auch Berichte über Vermögensverteilungen a la „10 % der Bevölkerung besitzt 90% des Vermögens“:
Laut ÖNB besitzen 50% der Bevölkerung 8 % des Nettovermögens. Das reichste Tausendstel der österreichischen Bevölkerung besitzt (zufällig) auch 8 %.
Das bedeutet dass 50 % der Bevölkerung im Grunde über gleich viel Vermögen verfügen wie die reichsten 0,1 % !! Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und es zeigt, dass sehr wenige Menschen sehr viel Vermögen besitzen, welches bei einer Erbschaft (derzeit) nicht zu versteuern ist.
Im Moment stehen in Österreich und der restlichen EU viele Erbschaften an! Nicht umsonst spricht man von „der Erbengeneration“.
Deutschland beispielsweise verdient bereits und in Zukunft mit der Erbschaftssteuer Millarden. Im kommenden Jahrzehnt werden dort 2,6 Billionen (sic!) vererbt! Österreich verdient nichts!
Heute ist mir zum ersten Mal klar geworden, was der Grund sein könnte, dass viele Menschen denken, sie wären von einer Erbschaftssteuer betroffen: Die Tatsache, dass man ab 60.000 Euro Einkommen vom „Spitzensteuersatz“ spricht legt nahe, dass man an der Spitze des Wohlstandes angekommen ist. Dies ist jedoch nicht im geringsten der Fall. Es gibt ganz andere Einkommen und somit Vermögensbildungen, und je höher diese sind, desto steuerschonender (Stichwort Stiftungen und Schweiz) wird aus Brutto Netto.
Das führt unmittelbar zu Punkt 2) Ich stelle hiermit folgende mit Zahlen und Beispielen unterlegbare Theorie auf: je höher das Einkommen, desto steuerschonender kann man aus Brutto Netto machen!
Beispiele hierfür gibt es genügend. Sei es über Stiftungen, die Gruppenbesteuerung oder schlichtweg in Steueroasen wie der Schweiz, Zypern, Caymans, Channel Islands etc. Ich wage zu behaupten, dass niemand aus der „Mittelschicht“ nur einen Cent in einer Steueroase „offshore“ oder in Stiftungen parkt. Das machen die „Oberschicht“ bzw. die „Superreichen“.
Daher ist für mich das Argument, dass es bei Erbschaften und deren Besteuerung (natürlich mit Freigrenzen) um bereits versteuertes Vermögen handelt, fast schon zur Gänze widerlegt.
Fazit: Meiner Ansicht nach unterliegen die Gegner der Erbschaftssteuer in der „Mittelschicht“ einem fatalen Irrtum, den sie teuer bezahlen. Außer sie gehören tatsächlich selbst zu denjenigen, die ungeheuer große Vermögen angehäuft haben. Dann wären sie aber nicht mehr die „Mittelschicht“.
Die „Oberschicht“ hingegen glaubt – mangels anderer Situationen – nicht daran, dass ein höherer (Steuer)-Beitrag ihrerseits gerechtfertigt ist, weil ihnen dadurch viele Sorgen erspart bleiben.
P.S.: Der oft von gewissen Politikern verwendete Stehsatz: „Leistung muss sich lohnen“ bekommt eine schiefe Optik, wenn man ihn mit dem Bankenspruch „Lassen Sie ihr Geld für sie arbeiten“ kombiniert. Daraus folgt: Superreiche haben haufenweisen leistungsfreies Einkommen! Aber dies ist ein Thema für einen weiteren Artikel. Ich habe auf jeden Fall noch nie Geld arbeiten gesehen. Es sind zum Schluss immer Menschen, die arbeiten!




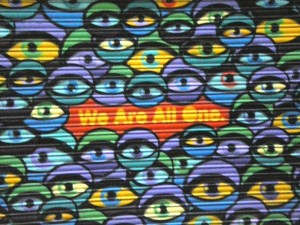

 Beitrag von unserem Gastautor Wolfgang Heindl:
Beitrag von unserem Gastautor Wolfgang Heindl:
 Bevor ich nun auf diese zwei „Irrtümer“ eingehe, möchte ich kurz folgende, immer wieder diskutierte, Punkte in den Raum stellen:
Bevor ich nun auf diese zwei „Irrtümer“ eingehe, möchte ich kurz folgende, immer wieder diskutierte, Punkte in den Raum stellen: